Predigten in Gottesdiensten
Hier kannst du meine gesammelten Predigten nachlesen. Hinweise zu den Lesepredigten, die ich als Grundlage benutzte, findest du auch.

Hier kannst du meine gesammelten Predigten nachlesen. Hinweise zu den Lesepredigten, die ich als Grundlage benutzte, findest du auch.

Gott segne dich und Gott halte dich.
Gott schaue dich an und schenke dir barmherzige Gnade.
Gott nehme dich in Obhut und gebe dir und der Welt allumfassenden Frieden.
Amen.

Benutzte Predigtentwürfe von Predigtentwürfen von Dr. Sigrun Welke-Holtmann und Pfarrer Prof. Dr. Christoph Dinkel. Beide Entwürfe betonen andere Aspekte des Predigttextes. Beide Ideen entsprechen meinen ersten Gedanken zum Text. So habe ich sie verbunden.
Predigt-Palmarum-240324

Benutzter Predigtentwurf von Prof. Dr. Axel Denecke. Diesen habe ich um Passagen aus dem Buch Amos ergänzt und als Dialogpredigt angelegt. Ungerade Absätze ich und gerade Absätze meine Dialogpartnerin und unsere Pastorin Anja Lipponer.
Predigt-Estomihi-240211

Die Predigt dreht sich um Jeremia, der Gottes Wort gegen alle Widerstände verkündete. Als Grundlage für die heutige Predigt zu Jeremia 23 nahm ich als Lektor den Vorschlag von Co-Dekan i.R. Dr. Gottfried Claß, veröffentlicht beim Zentrum Verkündigung in Frankfurt/Main.
Predigt-1.StgnT-240602

Der Israelsonntag ist ein besonderer Sonntag gerade in diesen Jahren. Als Predigtgrundlage habe ich die Arbeitshilfe zum Israelsonntag 2023 genutzt. Ich habe der Gemeinde dazu ein Bild der „Ecclesia and Synagoga in our times“ verteilt.
Predigt-10.StgnT-230813

Meine erste Predigt als Lektor. Leider konnten wir zum Thema Abendmahl kein Abendmahl dazu feiern. Die Vorlage schrieb Pfarrerin Esther Kuhn-Luz. Die Vorlage habe ich mir angeeignet und entsprechend angepasst.
Predigt-7.StgnT-230723

Grundlage ist der Predigtvorschlag vom Zentrum für Verkündigung, Frankfurt a.M.
Die Predigt wurde am Ambo sowie mitten in der Gemeinde gehalten.
Predigt-20StgnT-231022
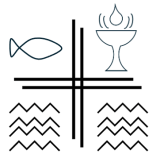
Dieser Sonntag steht im Kirchenjahr für die Tauferinnerung. Als Lektor orientiere ich mich an der Predigtexegese und den Hinweisen von Prof. Dr. Heike Omerzu und Dr. Susanne Ehrhardt-Rein sowie der Lektorenpredigt von Pfarrer Martin Hecker.
Predigt-6.StgnT-240707

Israelsonntag - die Predigt steht im Zeichen der Verbundenheit mit den Jüdinnen und Juden sowie Israel. Unser Glaube fußt auf ihrer Geschichte, er ist untrennbar und unleugbar mit ihrem Glauben verbunden, tief verwurzelt im Tanach mit der Tora, im Alten Testament.
Predigt-10.StgnT-240804

Können Christ:innen glücklich sein? Ich stütze mich auf den Entwurf von Bischof em. Prof. Dr. Martin Hein sowie auf die Exegese zum Predigttext von Prof. Dr. Corinna Körting und Daniela Fricke.
Predigt-16.StgnT-240915
Liebe Gemeinde,
Es ist heiß an diesem strahlenden Frühlingstag, obwohl die Sonne noch gar nicht ganz im Zenit steht. Die steinige Straße knirscht unter den Hufen der Tiere und den Sandalen der Menschen. Graubraune Steine. Flink flitzende Eidechsen. So früh schon verbrannte Erde. Ein steiniger Weg drückt unter Jesus Füße und ein schwerer Weg liegt vor ihm. Und dazu diese flirrende Hitze. Je näher er der Stadt kommt, desto mehr Menschen drängen sich auf den Straßen nach Jerusalem. Angelockt vom Passah-Fest. Dann geht auf einmal ein Raunen durch die Menge. Einige in seiner Nähe haben ihn erkannt und geben die Botschaft weiter. Wie ein Lauffeuer verbreitet es sich und bringt Bewegung und Musik in die Menschen. „Stell dir vor, Jesus kommt. Dieser Jesus, Du weißt schon, er ist auf dem Weg hierher!“
Sie laufen ihm entgegen, bilden eine Gasse, singen und schreien „Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel!“ Palmzweige in den Händen, Kleider auf dem Weg und ein Psalmlied auf den Lippen. Ein königlicher Empfang wird ihm bereitet. Ein Esel zur rechten Zeit und Jesus erfüllt die alttestamentliche Verheißung: „Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“
So in etwa stellt sich der Evangelist Johannes den Einzug Jesu‘ in Jerusalem vor. Wenn ich die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem höre, dann fehlt nur noch ein knalliges Walk-On-Lied, eines, wie es Sportler, Politiker und andere Stars nutzen, wenn sie „in den Ring steigen.“ Die Jünger hätten sicherlich gerne ein Walk-On-Lied gehabt für diesen triumphalen Einzug. Aber es gab noch keins für Jesus. So ist es ein Psalmlied zum Einzug in Jerusalem. Ist es sein Heimspiel? Nein, nicht wirklich. Es wird sein letztes Spiel - mit einem Ausgang, der für ihn schon klar ist. Aber für die jubelnde Masse noch nicht. Und für seine Freunde und Freundinnen schon gar nicht. Die genießen noch das Spektakel – endlich einmal im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit!
Mir kommen bei dieser Beschreibung sofort Bilder in den Kopf von Popstars, Sportlern, Trainern und Politikern, die bei ihrem Erscheinen frenetisch gefeiert werden. Ihre Fangruppe scharrt sich um sie, um ein wenig Glanz und Glamour abzubekommen. Nur einmal die Luft einatmen, die sie eingeatmet haben. Ein schnelles Selfie, ein kurzes Video. Ritsch klick Tic Toc. Sie glauben daran, solange es gut ist, solange es gut geht. Solange alle ihre Hoffnungen sich zu erfüllen scheinen. Champions league, Meisterschaft, Pokal, ein weiterer Megahit, Brot und Spiele, mehr Medaillen, die gewonnene Wahl.
Ein neuer König! Welche Pracht! Jetzt wird alles gut!
Wie wir wissen, war dies für die meisten nur ein kurzer Hype. Jesus wurde erhöht. Aber nicht auf den Thron, sondern an das Kreuz! Was für eine Schmach! Was für ein Loser! Wir suchen uns einen neuen Propheten, geh mir weg! Kein „Hosianna“ mehr, sondern „Kreuzigt ihn!“ und „Helfe er sich selbst!“. Hatespeech und Shitstorm!
Übrig blieben die hartgesottenen Fans, die kleine unerschütterliche Fanbase: Die, die es gesehen hatten; die, die es gehört hatten; die, die wirklich dabei waren und die, die sich im Herzen überzeugen ließen. Es blieben nur die, die wirklich glaubten!
Soweit der Palmsonntag – der Beginn einer sehr verdichteten unendlichen Zeit.
Und nun Hand auf’s Herz: Wer kennt die Bibel? Wer kennt das Neue Testament? Ich meine: so richtig. In- und auswendig. Also ich nicht. Ich lerne sie mit jedem weiteren Lesen neu kennen. Ich bin immer wieder erstaunt und beeindruckt und ein wenig verwirrt und gleichzeitig angeregt, mich weiter vorzutasten. Noch einen Vers, noch ein Kapitel. Und es wird später und später in der Nacht. Ein Diamant mit unendlichen Facetten. Immer strahlend, immer schön und mit jedem weiteren Blick lerne ich neue Perspektiven kennen. So auch für heute wieder. Philipper 2,5-11 – der heutige Predigttext, den ihr gleich hören werdet. Philipper 2,5-11 – na, geht euch da ein Licht auf? Macht’s da klick? Zugegeben: ich wusste es (auch) nicht. Also: in Philipper 2,5-11 steht der „Philipperhymnus“, ein urchristliches Lied.
Und so klingt er nach der Bibel ‚Hoffnung für alle‘:
5 Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild:
6 Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein.
7 Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir.
8 Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz.
9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht.
10 Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich.
11 Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr!
Warum Philipperhymnus? In der Stuttgarter Erklärungsbibel lese ich dazu: „Das Lied wurde vermutlich aus vorpaulinischer Tradition übernommen und hat im Gottesdienst seinen Sitz im Leben der Gemeinde. Solche Hymnen sind aus älteren Glaubens- und Bekenntnisformeln entstanden und stellen deren Aussagen über Christus in einen weiteren Horizont von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie preisen nicht nur die endzeitliche Vollendung seiner Herrschaft über die ganze Welt, sondern führen auch seine Herkunft immer weiter zurück auf Gottes Existenz vor aller Zeit. Ihre theologisch steilen Formulierungen sind keine spätere Erfindung, sondern haben alte Wurzeln im Gotteslob der frühen christlichen Gemeinden.“
Okay. Was wir gehört haben, hat sich also in den frühen christlichen Gemeinden entwickelt und ist in etwa sowas wie unser Glaubensbekenntnis heute. Paulus hat den Hymnus im Philipperbrief etwa um das Jahr 55 nach Christi Geburt weitergegeben. Er hat es nicht selbst verfasst – es stammt aus vorpaulinischer Zeit. Verfasst oder entwickelt wurde es von den allerersten gläubigen Christen. Nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt. Die Berechnungen zu diesem entscheidenden Jahr der Menschheit schwanken zwischen den Jahren 28 und 33 nach Christi Geburt. Der Hymnus hat sich also innerhalb von 20 Jahren entwickelt und wurde zum festen Bestand der Gemeinden.
In diesem Lied wird bereits sehr früh eines der Grunddogmen der Christenheit ausgesprochen: Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott – ein Paradox von bemerkenswert inspirierender Kraft.
War Jesus also ein über die Erde wandelnder Gott?
Die eine Lesart des Liedes ist die menschlich-irdische: Jesus wird geboren wie ein Mensch. Er lebt wie wir und stirbt den menschlichen Tod. Jesus ist Wanderprediger und Lehrer, Heiler und Hoffnungsträger, ein Bote von Gottes beginnender Herrschaft über die Erde. Er ist Bote und Bringer der anbrechenden Gerechtigkeit und des anbrechenden Friedens. Das ist die Geschichte, wie sie die Freundinnen und Freunde bis zum Palmsonntag sehen.
Die andere Lesart der Geschichte Jesu ist die göttlich-himmlische: Im irdisch-menschlichen Leben Jesu vollzieht sich zugleich und nur für Glaubende sichtbar ein himmlisches Ereignis von kosmischer Bedeutung. Der große Gott macht sich ganz klein und wird Mensch, das Unendliche erscheint im Endlichen, das Ewige im Zeitlichen. So leuchtet die Liebe Gottes hell durch das Leben Jesu hindurch. In Jesu Zuwendung zu den Menschen wendet sich Gott den Menschen zu. In Jesu Leiden leidet Gott. Und weil Gott die Menschen für sich und seine Liebe gewinnen will, gibt er sich ihnen hin, stellt sich auf sie ein, lebt ihr Leben und stirbt ihren Tod. Das ist die Geschichte, die die Freundinnen und Freunde erst später erkennen – nach der Passion, nach dem Kreuzestod, nach der Auferstehung. Als die Freundinnen und Freunde, die Jüngerinnen und Jünger, die Gläubigen begriffen hatten, was vor fast 2000 Jahren in Jerusalem passierte, was offenbart wurde, was hell aufschien, da schrieben sie erste Lieder: kein Walk-On-Lied, kein We are the champions. Aber ein Lied, das alles zusammenfasst und die Erinnerung bewahrt. Wenn sie es sangen, wenn wir es heute hören, dann zieht Jesus ein, dann kommt Gottes Liebe zu uns allen. Ein spätes, aber dafür ewiges Walk-On-Lied. Der Philipper-Hymnus.
Der Apostel Paulus und der in seinem Brief überlieferte Hymnus lehren uns eine doppelte Lesart der Geschichte Jesu: Sein ganz und gar menschliches Leben ist zugleich ein göttliches Ereignis, ein Ereignis der überströmenden Hingabe und Liebe Gottes zu den Menschen.
War Jesus also doch ein über die Erde wandelnder Gott? Nein. Jesus war ein wirklicher Mensch. Aber er war ein Mensch, in dessen Leben und in dessen Worten der Gott sichtbar und erfahrbar wird, der die Liebe ist. Mitten im irdisch-weltlichen Leben sollen wir Gott und seine Liebe erkennen und uns von ihr anstecken lassen. Und mitten im irdisch-weltlichen Leben sollen wir selbst diese Liebe leben und weitergeben an unsere Nächsten. In der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft. Immer und überall. So entspricht es der Gemeinschaft mit Christus Jesus.
Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild: 6 Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. 7 Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich: Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. 8 Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. 9 Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. 10 Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen: alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. 11 Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes, des Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr!
Amen.
1. Haltet euch fest! Ein Sturm braust auf! Der Prophet Amos, Lautsprecher Gottes, hat seinen legendären Auftritt, der den Herrschern und religiösen Führern im Nordreich Israels das Haar zerzaust! Amos spricht im Buch Amos Abschnitt 5 – nein – er spricht nicht – er spuckt es aus:
21 Gott sagt: »Ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich.
22 Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig.
23 Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Harfengeklimper.
24 Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein! Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss.
(Bibelversion Hoffnung für Alle)
Oder klingt das nicht eher nach einer Büttenrede am Faschingssonntag, was der Prophet Amos seiner Gemeinde vor fast 2800 Jahren und uns heute um die Ohren haut?
2. Ich will kurz etwas über das merkwürdige Leben des verrückten Propheten Amos erzählen. Er ist der älteste der „Schriftpropheten“ des AT und hat circa um 750 v. Chr. gelebt. Amos war ein Bauer, ein Maulbeerbaumzüchter, der eigentlich mit Gott und dem „richtigen“ Glauben und Ritus wenig zu tun hatte. Amos war kein studierter Gelehrter oder Priester. Er wollte nur in Ruhe seine Maulbeerbäume pflanzen und die Früchte ernten. Doch dann rief ihn Gott an, er solle in der damaligen Metropole Bethel, wo das Zentralheiligtum war und der strenge König Jerobeam herrschte, gegen das Treiben im Tempel predigen. Gegen das flotte und verschwenderische Leben des Königs und sämtlicher Priesterschaft weissagen.
3. Wie auch andere Propheten sträubt Amos sich zunächst gegen Gottes Auftrag und will nicht. Und doch muss er dann - kann nicht anders - darf nicht anders. Denn Gott ist für ihn so bedrängend, dass er sich dem nicht entziehen kann. Und so tritt er auf, dieser närrische Prophet, dieser prophetische Narr und hält seine Reden, immer darauf vertrauend, dass der Geist Gottes aus ihm spricht:
„Ihr fetten Basanskühe“, so nennt er die edlen Damen bei Hofe. „Wehe den Sorglosen in Zion…, den Vornehmen…, den Herren des Hauses Israel…, die ihr auf Elfenbeinbetten liegt, ausgestreckt auf euren Lagern…, die da trinken den feinsten Wein…, aber sich nicht kümmern um den Schaden Josephs. Darum schwört nun der Herr bei sich selbst: Sie alle sollen voran in die Verbannung wandern, und es vergeht der Jubel derer, die auf den Lagern sich strecken.“
Ha, wenn das keine närrische Büttenrede ist! Ich könnte euch das ganze Amos-Buch vorlesen - es ist voll von diesen Narreteien.
4. Im Namen Gottes sagt er:
„Ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Harfengeklimper.“
Also, das ist stark. Die frommen Israeliten feiern im zentralen Heiligtum in Bethel, heute vergleichbar etwa mit dem Kölner Dom oder dem Hamburger Michel oder dem Petersdom, einen feierlichen Gottesdienst; liturgisch einwandfrei, pompös, mit großen Prozessionen, vielen Brandopfern von Tieren und Feldfrüchten. Alles korrekt – so wie es der liturgische Ablauf vorsieht. Der Oberpriester Amazja gibt auch seinen Segen dazu – und dann das. Gott wendet sich ab, nein nicht nur das, er spuckt es aus: „Ich mag das nicht riechen – es stinkt gen Himmel.“ Und all das sagt der närrische Amos im Auftrag Gottes.
5. Und Amos sagt noch mehr:
„So spricht der Herr: Die Leute von Juda begehen ein abscheuliches Verbrechen nach dem anderen. Sie treten mein Gesetz mit Füßen und leben nicht nach den Geboten, die ich, der Herr, ihnen gegeben habe. ... Das werde ich nicht ungestraft lassen! Ehrbare Menschen, die ihnen Geld schulden, verkaufen sie in die Sklaverei, ja, sie verkaufen einen Armen schon, wenn er ein Paar Schuhe nicht bezahlen kann! Den Wehrlosen treten sie in den Staub, und dem Schwachen verweigern sie sein Recht. ... Neben jedem Altar machen sie sich weiche Polster aus den Kleidern, die sie den Armen als Pfand wegnehmen. Im Tempel ihres Gottes saufen sie Wein, den sie für nicht bezahlte Schulden gefordert haben!“
6. Ich will jetzt nicht spekulieren, wie das damals vor 2800 Jahren auf die Leute wirkte, aber es war wohl heftig. Und deshalb wird Amos aus Bethel verbannt:
Amazja, der oberste Priester in Bethel, sandte einen Boten zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm ausrichten: »Amos zettelt mitten in Israel einen Aufstand gegen dich an! Seine Reden sind unerträglich! ... «
Zu Amos sagte Amazja: „Du Prophet, verschwinde von hier und geh heim nach Juda! Dort kannst du weiter weissagen und dir so dein Brot verdienen. Aber hier in Bethel ist Schluss damit! Denn hier steht der Tempel des Königs, das wichtigste Heiligtum Israels.“
Aber Amos war kein Profi-Prophet, wie es viele aus Prophetenschulen gab. Er tat es nicht des Geldes wegen. Er sagte nur die Wahrheit, aber keiner wollte diese hören oder sehen. So musste Amos gehen, er wurde ausgewiesen.
7. Was sagt uns Amos heute? Wie sollen wir heute mit Amos‘ Text umgehen?
Erstens: Wir könnten natürlich sagen: Ach, ist ja im Grunde nur eine verrückte Büttenrede am Faschingssonntag. Da ist vieles erlaubt. Ein bisschen verunglückt vielleicht. Aber wir sind tolerant, soll er doch seine wilden Ideen rausschreien. Wir lachen darüber und gehen einfach weiter. So könnten wir reagieren. Aschermittwoch ist ja alles vorbei und der normale Alltag hat uns wieder.
8. Zweitens: Wir könnten natürlich auch sagen: Das darf er nicht, das geht dann doch entschieden zu weit! Das muss verboten werden! Warum steht das eigentlich in der Bibel? Da steht ja sowieso viel Gestrüpp in der Bibel, wie schon der große Karl Barth und Luther sagten: „stroherne Episteln“. Das muss man nicht alles glauben und ernst nehmen. Also weg damit, so etwas wollen wir nicht hören. Lass uns in Ruhe! Lass uns Gottesdienste liturgisch korrekt feiern in unseren schönen Kirchen und am Sonntag unseren Glauben glauben. Alltags ist das egal.
9. Drittens: Wir könnten aber auch sagen; Ja klar, der Amos übertreibt hier, muss er vielleicht auch, damit er gehört wird. Hat er recht? Vielleicht sollten wir uns fragen: Wo entsprechen unsere Gottesdienste und unser ganzer christlicher Glaube wirklich dem Willen Gottes? Wo feiern wir fromme Gottesdienste, feiern aber im Grunde nur uns selbst? Wo sagen wir „Gott“, meinen aber im Grunde nur uns selbst, nur unsere eigene Frömmigkeit und vermeintliche Wohlanständigkeit? Wo dienen wir nicht mehr Gott, sondern nur unserem eigenen Selbst und drehen uns nur noch um uns selbst? Wo feiert sich unsere Kirche nur selbst und ist nicht mehr „für andere“ da?
Wir sollten Gott feiern und ehren und nicht das Geld, nicht die Influencerin, nicht das Freizeitvergnügen, nicht uns selbst in der Selbstverwirklichung. Ich selbst neige schon dazu, diese dritte Variante zu bevorzugen, auch wenn ich mich dabei für manche selbst zum Narren mache.
10. Viertens: Was bietet Amos nach diesem geharnischten Rundumschlag in der „Bütt“ schließlich an Positivem und Konstruktivem an? „Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein! Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss.“
Wir können uns daran erinnern, wo wir herkommen, was der Ausgangspunkt unseres Glaubens war und ist. Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit, mit denen er uns für sich gewonnen hat. Und wir können uns engagieren, dass Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit wirklich unter uns zu wirken beginnen, dass sie „strömen wie ein nie versiegender Fluss.“
11. Halte ich jetzt selbst eine Narrenrede? Ich weiß es nicht! Es kann ja sein, dass Amos‘ positive moralische Forderung der Höhepunkt seiner ganzen Narretei ist. Dass also die Vision von „Recht und Gerechtigkeit“ unter uns allen der verrückten Büttenrede die Krone aufsetzt.
Aber vor ca. 2000 Jahren gab es ja noch einen, der solche Visionen hatte, sie weitersagte und als dummer Narr in den Augen der priesterlichen Oberhirten scheiterte. Nur verbannten sie ihn nicht, sie kreuzigten ihn.
Ich glaube auch an diesem Karnevalssonntag daran: Gottes Recht und Gottes Gerechtigkeit, seine Liebe und seine Vergebung gelten für uns alle, ganz bestimmt, darauf steht unser Glaube. Und ich glaube, dass wir in Liebe handeln sollen, damit „Recht und Gerechtigkeit“ für alle Menschen, auf der ganzen Erde, und ganz konkret für die Frau und den Mann neben uns, sich ausbreiten wie ein „nie versiegender Fluss.“ Und ich hoffe, ihr seid dabei, Recht und Gerechtigkeit auszugießen. Ich hoffe, ihr seid auch Wasserträger Gottes – so verrückt bin ich tatsächlich! Ich Narr im Namen Christi! Hoffentlich bin ich einer und bleib auch einer bis zu meinem Ende!
Amen!
Abschnitt 1 - Ambo
Der heutige Predigttext, den wir gerade hörten, spricht vordergründig zwei Themen an:
1. die Ehescheidung sowie
2. die Segnung der Kinder.
Ehescheidung? Mich beschleicht bei dieser absoluten Aussage leichtes Unbehagen. Dieser kurze Auszug aus dem Evangelium wäre für mich heutzutage Grundlage eines ganzen Wochenseminars. So schaue ich heute nur kurz auf die Verhältnisse zu Jesu Zeit:
Nur Männer konnten eine Scheidung aussprechen. Nur Männer konnten faktisch ihre Frau verstoßen. Dies bedeutete Armut, Elend und Ehrverlust für Frauen und Kinder. Und so erscheint diese Aussage in einem anderen Licht: Jesus fordert einfach das Recht für Frauen und deren Kinder ein, wirtschaftlich und rechtlich versorgt zu bleiben. Er fordert, dass Männer nicht willkürlich über das Wohl und Wehe von Frauen und Kindern entscheiden können und setzt dagegen:
Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen.
Die Absolutheit seines Satzes ist vor dem Hintergrund der damaligen Verhältnisse zu sehen. Heute kann er sicherlich facettenreich erörtert werden.
Und die Segnung der Kinder? Für mich einfach selbstverständlich.
Für damalige Zeit fast unvorstellbar, denn Kinder waren in der Verfügungsgewalt des Vaters und wurden nur von ihm gesegnet.
Jesus bricht dieses Männerrecht auf. Er ermöglicht mit seinem Segnen ab sofort Gottes Beistand für alle, die keinen anderen Schutz und Hilfe haben.
Jesus setzt gegen die verschlossenen Herzen und die Schroffheit vor allem der Männer Gottes Gebot. Und das heißt: Liebe!
Und wie gehen wir nun mit diesem Evangelium heute um?
Was kann es uns aktuell sagen?
Hören wir dazu ein bekanntes Lied.
Abschnitt 2 - sitzend
Lied „Gebt den Kindern das Kommando“ von Herbert Grönemeyer gekürzt 2:26
Abschnitt 3 - Ambo
So sang Herbert Grönemeyer 1986. Ein Lied, dass viele Menschen heute noch berührt und bewegt.
In der Bibel kommen Kinder an 600 Stellen vor. Das ist gar nicht so wenig und im Psalm 127 heißt es beispielsweise: „Kinder sind ein Geschenk von Gott, eine Gabe des Herrn.“ Jesus ist sich dessen wohl bewusst. Und welchen Stellenwert Kinder bei Jesus und bei Gott haben, wird im heutigen Evangelium deutlich.
Lasst uns mal in die Szene des Predigttextes eintauchen, um genauer hinschauen zu können.
Abschnitt 4 – in der Gemeinde im Gang
> extra Pult, Mikrofon – ggf. zwei bis drei weitere SprecherInnen für Rolle Jünger und Rolle Eltern
Jesus steht in einer Traube von Menschen und erzählt von Gott, von seiner Liebe, Gnade und Barmherzigkeit uns Menschen gegenüber. Jesus predigt vom nahen Gottesreich und dass wir wachsam sein sollen. Er wiederholt uns gegenüber sein Doppelgebot der Liebe: „Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das andre ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese beiden.“
Untermauert werden all diese Worte durch die Jünger, die immer wieder staunend von den vielen Wundern berichten, die Jesus vollbracht hat.
Während wir gespannt allem lauschen, sehen wir, wie sich einige Mütter und Väter mit ihren kleinen Kindern unserer Gruppe nähern. Auch sie haben viel über Jesus, seine liebevolle Rede über Gott und seine Macht gehört, Sünden zu vergeben. Nun wollen sie zu ihm, damit er ihre Kinder segnet.
Doch bevor sie nur in seine Nähe kommen können, treten einige der Jünger vor sie und bauen sich wie ein Schutzwall vor ihnen auf.
„Was wollt ihr?“ fragen sie abwehrend und so laut, dass auch wir es hören können.
„Wir wünschen uns, dass Jesus unsere Kinder segnet.“ antworten die Eltern zaghaft.
Doch sie hören nur ein „Ihr stört! Jesus hat Wichtigeres zu tun als sich um euch zu kümmern! Was er zu sagen hat, können eure Kinder eh nicht verstehen. Der Glaube ist kein Kinderkram.“
Es ist still geworden um uns herum.
Jesus hat inzwischen aufgehört zu erzählen.
Er schaut seine Jünger irritiert an.
Wir spüren, wie sich die Atmosphäre ändert.
Wir merken, wie Jesus wütend und zugleich traurig wird.
Er geht ruhig, aber auch ganz entschlossen auf die Jünger und die Eltern mit ihren Kindern zu.
Schließlich sagt er zu seinen Jüngern:
„Was bildet ihr euch eigentlich ein?
Habt ihr denn so gar nichts verstanden?
Vor ein paar Stunden habe ich vor euren Augen und Ohren noch mit den Schriftgelehrten über die Ehe und die Ehescheidung diskutiert. Ich habe versucht ihnen und euch klarzumachen, dass alle Menschen Anteil am Reich Gottes haben.
Von Anbeginn als Mann und Frau geschaffen.
Als Menschen!
Als seine Ebenbilder.
Gott hat keine Hierarchien eingerichtet.
Der Mann steht nicht über der Frau.
Und die Erwachsenen nicht über den Kindern.
Die Frau genießt die gleiche Würde, das gleiche Recht wie der Mann. Und das gleiche gilt auch für die Kinder.
Ach, meine Jünger. Meine armen Jünger. Nichts habt ihr verstanden.
Eure Herzen sind genauso hart wie die der Schriftgelehrten.
Ihr habt ein Herz aus Stein, wie all die Menschen, die meinen, etwas Besseres zu sein.
Schaut euch die Kinder an! Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht Anteil haben am Reich Gottes.
Lasst es mich anders sagen: Nur wenn ihr werdet wie die Kinder, könnt ihr Anteil haben am Reich Gottes.
Ich weiß, das kehrt die normalen Verhältnisse um. Aber genau so ist Gott.
Das Himmelreich gehört denen, die so sind wie diese Kinder.“
Wieder lauschen alle wie gebannt den Worten Jesu. Was soll das heißen:
Nur wenn ihr werdet wie die Kinder, könnt ihr Anteil haben am Reich Gottes?
Jesus spürt unser Unverständnis. Er dreht sich zu uns um und erklärt:
„Eltern lieben ihre Kinder, nicht weil sie alles richtig machen, sondern um ihrer selbst willen. Oder?
Und Kinder vertrauen dieser Liebe. Schaut, wie sie in den Armen ihrer Mutter einschlafen oder ihrem Vater entgegenspringen, wenn er heimkommt.
Kinder sind Vorbilder im Vertrauen können. Sie vertrauen blind der Liebe ihrer Eltern, ihrer Großeltern oder auch ihrer Geschwister.
Sie probieren viel aus und lernen durch ihr gutes Tun.
Genau so will uns Gott!
Er liebt uns um unserer selbst willen, und nicht nur dann, wenn wir es ihm recht machen. Er liebt uns ohne Vorbedingungen!
Und: Er öffnet seine Arme, wenn wir ihm entgegenspringen und ihm erzählen wollen, was wir auf dem Herzen haben, was uns beschäftigt.
Kindliches Gottvertrauen.
Seine Nähe suchen – ohne Furcht.
Das können wir von den Kindern lernen.
Einfach Dasein.
Vor Gott da sein.
Von Gott lernen.
Sich hinsetzen, anlehnen und schweigen.
So unkompliziert, so kindlich einfach geht glauben.
Kinder berechnen nicht, was sie tun.
Die Welt gehört in Kinderhände.“
Und nachdem Jesus das alles zu uns gesagt hat, dreht er sich um, geht zu den Kindern, nimmt sie in die Arme, herzt sie und segnet sie.
Er wendet sich den Kindern zu. Er bricht mal wieder mit aller Distanz und auch mit den gesellschaftlichen Konventionen seiner Zeit.
In diesem Moment merken sowohl die Jünger als auch die Zuhörer seiner Reden, dass hier etwas Großartiges geschieht.
In diesem Moment eröffnet Jesus den Kindern eine ganz persönliche Beziehung zu Gott.
Er lässt sie seine Nähe, Liebe und Zuneigung spüren.
Soweit die Szene aus dem heutigen Evangelium.
Abschnitt 5 - Ambo
Jetzt schaue ich nochmal auf den Predigttext und sehe hinter diesen scheinbar getrennten Themen „Ehescheidung“ und „Kindersegnung“ nur noch ein großes Thema, gegen das sich Jesus wendet:
Gegen Regeln, die nicht Gottes Wille entsprechen, sondern von Erwachsenen mit hartem und Gott gegenüber verschlossenem Herzen erlassen wurden. Oft zutiefst ungerecht gegenüber Machtloseren, vor allem gegenüber Frauen und Kindern.
Und diesen menschlich-unmenschlichen Gesetzen setzte Jesus diese zentrale Aussage gegenüber: Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen.
Was ist also die Botschaft für die, die nicht mehr Kind sind?
Du wirst in das Reich Gottes hineinkommen, wenn Du zulässt, dass Vorurteile, unsinnige Regeln und Einschränkungen vom Geist weggeweht werden.
Wenn Du Freude an der Welt hast, sie für die nachfolgenden Generationen erhalten willst und so handelst.
Du wirst in das Reich Gottes hineinkommen, wenn Du deinen Gott einfach nur liebst und deine Nächsten wie dich selbst. Nicht nur hier in der Kirche, sondern vor allem draußen in der Welt, im Alltag.
Und die Liebe Gottes, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen und erträumen können, bewahre unsre Herzen und Sinne in Jesus Christus.
Amen.
Liebe Gemeinde,
auf dem Bild sehen Sie eine Skulptur mit zwei Gestalten. Sie könnten Geschwister sein, so ähnlich sehen sie sich. Jede Gestalt trägt eine Krone und jede schaut hinüber zur anderen: Was hast Du da? Die eine rechts im Bild hält auf dem Schoß eine aufgeschlagene Bibel, die andere links im Bild eine geöffnete Torarolle mit den fünf Büchern Mose. Ihre Körper und Beine sind noch ein wenig voneinander abgewandt, doch ihre Köpfe drehen sich schon zur anderen hin und sie sitzen aneinander, Schulter an Schulter. Im Moment ändert sich etwas bei ihnen. Die beiden gucken noch etwas scheu. Aber jede schaut interessiert auf das, was die andere da in Händen hält und was sie zu bieten hat. So fängt das Lernen an. So beginnt gegenseitige Wertschätzung. So wächst gegenseitige Zuneigung. Sie waren sich fremd geworden und voneinander weggerückt. Jetzt erkennen sie sich wieder, rücken aneinander und sehen, was sie mit der anderen gewinnen.
Das Kunstwerk heißt „Ecclesia and Synagoga in our times“ – „Kirche und Synagoge in unserer Zeit“ – entworfen hat es der Künstler Joshua Koffman. Seit 2015 steht es auf dem Campus der St. Joseph’s Universität in Philadelphia in den USA. Dort zeigt es sinnbildlich, wie sich die christlich-jüdischen Beziehungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert haben.
Sie kennen vielleicht die alten Darstellungen der Ecclesia und Synagoga-Frauengestalten, wie sie beispielsweise am Straßburger Münster, der Trierer Liebfrauenkirche, dem Bamberger Dom und vielen anderen Kirchen zu sehen sind. Bei den alten Darstellungen gibt es eine Siegerin und eine Verliererin – die eine darf ihre Krone tragen, die andere muss eine Binde vor den Augen tragen. Die eine hält den Abendmahlskelch in die Höhe, die andere muss die Bundestafeln mit den Zehn Geboten sinken lassen. Solche Darstellungen haben über Jahrhunderte hinweg christliche Verachtung des Judentums in Stein gemeißelt und Judenfeindlichkeit gestützt.
Bei Joshua Koffmans Darstellung treffen sich Ecclesia und Synagoga, Judentum und Christentum auf gleicher Höhe. Sie vermitteln eine Ahnung davon, wieviel jüdische und christliche Menschen voneinander lernen können, wenn sie einander zuhören, sich anschauen, aufeinander achten.
Und das Lernen ist zentral für uns Menschen, weil sich das Leben ständig ändert und uns immer wieder neu herausfordert. Lernen ist zentral, da wir immer weiter bessere Antworten finden müssen als bisher geschehen. Und dabei die Bundestafeln oder die Torarolle sinken lassen? Niemals! Die zehn Gebote sind zentral für bessere Antworten!
Liebe Gemeinde, die Bibel stellt uns eine Gestalt als einen besonderen Lehrer in allen Lebenslagen vor: Es ist Mose. Mose unser Lehrer, so heißt er in der jüdischen Tradition – Mosche Rabbenu. Bis heute ist er Richtschnur und Vorbild im Judentum, und so ist er auch Vorbild für Jesus in den Evangelien. In der Lesung vom höchsten Gebot haben wir eben davon gehört. Was in der Bibel am Anfang des 2. Buches Mose mit einem Baby in einem Binsenkörbchen auf dem Nil beginnt, endet mit einer großen abschließenden Rede eines besonderen Lehrers an das ganze Volk Israel. Fast das komplette 5. Buch Mose dauert diese Rede. In ihr schaut Mose zurück und fasst zusammen, was für die Zukunft des Volkes Israel wichtig ist. Er gibt Antwort auf die Fragen: Worauf kommt es an? Wie sollst Du im gelobten Land leben? Was sollst Du lernen? Was ist Deine Aufgabe? Wie kannst Du Dir das alles merken? Was hilft Dir? Was kann all das kaputt machen? Und die Antworten auf diese Fragen gelten im Grunde heute genauso wie damals. Hören wir einfach mal zu, was Mose ziemlich am Anfang seiner Rede im 5. Buch im 4. Kapitel sagt (nach der BasisBibel):
5 Vergesst nicht: Ich habe euch die Gesetze und Bestimmungen gelehrt, wie es mir der Herr, mein Gott, befohlen hat. Handelt danach in dem Land, in das ihr kommt! Ihr sollt es in Besitz nehmen.
6 Befolgt die Gebote und handelt danach! Denn darin liegen eure Weisheit und euer Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen hören und dann über euch sagen:
»Wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk!«
7 Urteilt selbst: Welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns.
8 Welches andere große Volk hat Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere?
Nur wir haben diese ganze Weisung, die ich euch heute verkünde.
9 Pass auf, Israel, und achte gut auf dein Leben! Vergiss die Ereignisse ja nicht, die du mit eigenen Augen gesehen hast! Behalte sie ganz fest in deinem Herzen dein ganzes Leben lang! Erzähl deinen Kindern und deinen Enkeln davon!
10Vergiss nicht den Tag, an dem du vor dem Herrn, deinem Gott, gestanden hast. Damals, am Horeb, gab er mir den Auftrag:
»Hol mir das Volk zusammen! Sie sollen hören, was ich selbst ihnen sagen will. So lernen sie, mir jeden Tag mit Ehrfurcht zu begegnen, so lange sie auf der Erde leben. Das sollen sie auch ihren Kindern beibringen.«
11 Also seid ihr näher gekommen, bis ihr am Fuß des Berges versammelt wart. Der Berg stand in Flammen, bis zum Himmel loderten sie. Ringsum waren Dunkelheit, Wolken und Finsternis.
12 Da redete der Herr, euer Gott, zu euch, mitten aus dem Feuer hörtet ihr ihn sprechen. Ihr konntet den Klang seiner Stimme hören, aber eine Gestalt habt ihr nicht gesehen. Da war nur diese Stimme.
13 Er verkündete euch seinen Bund, den ihr halten sollt – die Zehn Worte. Die schrieb er auf zwei Tafeln aus Stein.
14 Mir befahl der Herr damals, euch die Gesetze und Bestimmungen zu lehren. Die sollt ihr im versprochenen Land halten, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen.
15 Passt gut auf, achtet auf euer Leben! Denn ihr habt keine Gestalt gesehen, als der Herr, euer Gott, zu euch sprach.
Am Horeb sprach er mitten aus dem Feuer.
16 Es wäre verhängnisvoll, wenn ihr euch ein Bild von Gott macht:
Macht euch keine Nachbildung, keine männliche oder weibliche Götterfigur!
17 Macht euch kein Abbild eines Tieres, das auf der Erde lebt, oder eines Vogels, der am Himmel fliegt!
18 Macht euch auch kein Abbild eines Kriechtieres oder eines Fisches, der unten im Wasser lebt!
19 Lass dich auch sonst nicht verführen: Du richtest die Augen Richtung Himmel und siehst Sonne, Mond und Sterne? Du siehst das ganze Heer des Himmels? Dann bete sie nicht an und verehre sie niemals! Denn der Herr, dein Gott, hat sie anderen gegeben:
Andere Völker unter dem Himmel mögen sie anbeten.
20 Aber der Herr hat euch genommen und aus Ägypten geführt. Dieses Land wirkte auf euch wie ein Schmelzofen. So wurdet ihr Gottes eigenes Volk, sein Eigentum. Das seid ihr auch heute noch.
Liebe Gemeinde,
mit unserem Abschnitt beginnt ein Kernstück der Rede des Mose: Ein Kapitel später folgen noch die Zehn Worte bzw. die Zehn Gebote. Und ein Kapitel weiter kommt das „Schma Jisrael“: „Höre, Israel: Der Herr ist unser Gott, der Herr allein! Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft.“. Eben haben wir im Evangelium gehört, wie Jesus genau dies zitiert, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird.
„Höre Israel“, so beginnt schon die Rede im 5. Buch Mose wenige Verse vor unserem Predigtabschnitt. Das Wort vom Berg ist zunächst Lehre für das Volk Israel. Dieses Wort mit seinem besonderen Klang pflanzt sich fort von Generation zu Generation – bis heute. Von Anfang an geht die Lehre auch hinaus in die Welt und am Ende werden die Völker nach Jerusalem zum Berg Zion kommen, um diese Weisung und Lehre zu lernen und ihre Schwerter zu Pflugscharen zu machen. Diese friedvolle Vision entwickeln die Propheten Israels aus dem Wort vom Berg Horeb in einer feindseligen Gegenwart voller Zerwürfnisse und Krieg. Mose, der Lehrer Israels, inspiriert die ganze Menschheit. In seinem jüdischen Volk und weit darüber hinaus hat er seither Politiker und Freiheitskämpferinnen angeregt, ermutigt und geleitet. Die Lehre für Israel nährt und trägt bis heute viele, die nach Gerechtigkeit und Freiheit hungern und dürsten – und auch uns.
Der Mose, der hier redet, ist ein erfahrener Lehrer. Er weiß, dass ein Mensch auf ganz verschiedene Weise etwas lernen kann. Das Lernen fängt damit an, dass jemand mich ansieht, mir überhaupt etwas zutraut und mir eine Aufgabe anvertraut. Was mir dabei hilft, ist ein gutes Vorbild, an dem ich mich orientieren kann. Lernen funktioniert, wenn jemand eigene Erfahrungen und Einsichten weitergibt, erzählt, was ihm oder ihr geholfen hat, was Kraft gegeben hat und was neue Kenntnisse und Einsichten überhaupt bringen. Idealerweise erzählen auch Eltern ihren Kindern davon und die erzählen es ihren Kindern weiter. Eine Generation lebt es der kommenden Generation vor. Dabei funktioniert das zum Bösen wie zum Guten. Deshalb schärft der Lehrer Mose in seiner Rede immer wieder die Verantwortung derer ein, die Entscheidungen treffen: Alles hat Konsequenzen, nicht nur für Euch, sondern auch für die, die nach Euch kommen. Deshalb: Höre gut, Sieh hin, Pass genau auf...
Ganz wichtig ist in unserem Abschnitt das Verbot, sich Bilder zu machen. Natürlich gibt es großartige Kunst in Wort, Bild und Ausdruck, die Mut macht, tröstet, Orientierung gibt. Hier geht es um etwas Anderes: Etwas in einen Rahmen hineinzustecken, in Form zu gießen oder in Stein zu meißeln, birgt immer die Gefahr, eigene Vorstellungen und Bilder festzuschreiben und vorzuschreiben, so etwa:
Gott ist „ein alter Mann mit weißem Bart“,
Jesus sah aus wie wir,
Jesus hatte lange Haare und einen Bart.
Und dann gibt es die fatalen Bilder, wie „die Juden“ angeblich sind oder „die Schwarzen“ oder „die Sinti und Roma“ oder „die Geflüchteten“ oder auch einfach „die aus dem anderen Stadtteil“ oder eben einfach „die Anderen“. Pauschale Bilder sind einfach, aber der Lehrer Mose ruft hier: Stopp! Das Denken in Schubladen und festgefügten Bildern passt nicht zum Klang der Stimme Gottes vom Berg:
15Passt gut auf, achtet auf euer Leben! Denn ihr habt keine Gestalt gesehen, als der Herr, euer Gott, zu euch sprach. ... Macht euch keine Nachbildung, keine männliche oder weibliche Götterfigur!
Ja – Mose hat sich an seine eigene Familie, seine Verwandten und Geschwister, sein Volk gewendet. Doch an ihrer konkreten Geschichte, an ihrem persönlichen Vorbild, aus ihren Gesetzen und Bestimmungen können auch wir etwas lernen, die wir nicht zu dieser Familie gehören. Die Bibel rechnet von Anfang an damit, dass die Worte vom Berg etwas in Gang setzen können, das größer ist als die Menschen, mit denen er geredet hat.
Was Mose seinem Volk hier nahebringt und anvertraut, sprüht Funken, leuchtet weit über diesen Kreis hinaus und wird zur Inspiration für viele – auch für uns:
Befolgt die Gebote und handelt danach! Denn darin liegen eure Weisheit und euer Verstand, was den anderen Völkern auffallen wird. Sie werden von allen diesen Gesetzen hören und dann über euch sagen:
»Wie weise und vernünftig ist doch dieses große Volk!«
Urteilt selbst: Welches Volk ist ein so großes Volk und hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott? Wir beten zu ihm und er hört uns.
Welches andere große Volk hat Gesetze und Bestimmungen, die so gerecht sind wie unsere? Nur wir haben diese ganze Weisung, die ich euch heute verkünde.
Liebe Gemeinde,
noch einmal schaue ich auf die beiden Figuren des Kunstwerks und denke an den großen Lehrer, wie er uns im 5. Buch Mose begegnet. Die beiden Gestalten reißen sich nicht den Schatz der jeweils anderen unter den Nagel oder stehlen die Worte der anderen. Sie schauen interessiert, was die andere zu bieten hat! Jede hat ihre eigene Tradition, und die ist jeweils eng mit der anderen verbunden, aber unterscheidet sich zugleich von der anderen. Jede hält ihre eigene Tradition in ihrer unterschiedlichen Gestalt hoch. Und so kann echtes Lernen funktionieren: Alle bringen etwas Kostbares mit, alle behalten die Deutungshoheit. Vielfalt und Verschiedenheit haben einen Wert. Und wie wir wissen, sind beide untrennbar miteinander verbunden. Geht es der einen schlecht, leidet auch die zweite. Geht es beiden gut, freuen sich beide! Das lernen wir auch heute immer aufs Neue. Und dieses gemeinsame Lernen übt den Respekt und die Liebe, die Begeisterung und die Inspiration für den Reichtum und die Fülle der Gnade Gottes, die höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Amen.
Sie bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Amen.
Liebe Gemeinde,
bereits nach der Idee, unser neues Kirchengebäude zu bauen, brachen in der Gemeinde unruhige Zeiten an. Kaum waren diese vorbei, die Kirche eingeweiht, brach die Pandemie los. Und nichts war mehr wie vorher.
3 Jahre lang. Als die Pandemie verklang und alles wieder normal werden konnte, kündigte sich der Wechsel auf der Pastorenstelle an. Und bereits vorher wurden lange Zeiträume durch TeilzeitvakanzvertreterInnen überbrückt. Nun wird die Pastorenstelle sehr schnell neu besetzt. Dafür sage ich aus tiefstem Herzen: Gott sei Dank! Und schon sehen wir die nächste Kirchenvorstandswahl am Horizont.
Wir haben in den letzten Jahren viel erlebt. Viel ist in der Welt geschehen, viel ist in der Gemeinde geschehen und vieles hat sich gegenseitig beeinflusst. Viele wenden sich von der Kirche ab, verlieren das Interesse oder verlassen aus wirtschaftlicher Not die Kirche, um Kirchensteuer zu sparen.
Wie anders klingt da unser heutiger Predigttext der Apostelgeschichte aus dem 2. Kapitel die Verse 41 – 47. Er ist überschrieben mit dem Titel „Das Leben in der Gemeinde“, hier in der Fassung der BasisBibel:
Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu.
Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten.
Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen. Denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen.
Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz.
Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen – je nachdem, wie viel jemand brauchte.
Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl.
Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden.
Meine Güte, welche Idealzustände! Menschen, die alle zu einer Gemeinde dazugehören und füreinander sorgen, miteinander teilen; die fürsorglich miteinander umgehen und einen Blick haben für soziale Gerechtigkeit. Sie verkauften Güter und Habe, verkauften ihre Immobilien und was sie sonst hatten. Jeder bekommt das, was er und sie nötig haben. Niemand geht leer aus, niemand hat zu viel. Einmütig waren sie – verstanden sich in ihrem gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Christus als eine Gemeinschaft. Sie trafen sich regelmäßig, um miteinander Gottes Wort zu hören – im Tempel in Jerusalem. Denn das blieb „Haus Gottes“ – auch für diejenigen, die sich zu Christus bekannten. Denn Jesus selbst hatte auch hier gelehrt und war mit vielen Menschen im Gespräch gewesen. Aber sie trafen sich auch in den Häusern, reihum. Sie aßen miteinander – nicht nur die Freunde, sondern alle wurden irgendwo eingeladen. Sie teilten das Brot und erinnerten sich dabei immer an denjenigen, der ihnen das beigebracht hat: Wenn wir Brot teilen, dann werden wir satt. Dann denken wir immer auch an den, der für uns Brot des Lebens geworden ist.
Sie beteten miteinander, waren voller Dankbarkeit, lobten Gott und beteten auch füreinander.
So muss Gemeinde sein!
Ist so Gemeinde?
Wir kennen das anders – hier in Hannover, in Bothfeld, aktuell und aus den Entwicklungen der letzten Jahre. Ja, wir, die wir hier sitzen, verstehen uns als Gemeinde. Wir zahlen Kirchensteuern, um die Arbeit der Kirche zu unterstützen: die Seelsorge, die Diakonie, die Bildungsarbeit, die Kirchenmusik. Die Kirchensteuer – eine kleine Erinnerung daran, dass sie „den Erlös verteilten an die Bedürftigen – je nachdem, wie viel jemand brauchte.“
Aber dass wir so füreinander sorgen, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben wird, das kennen wir nicht. Wir haben dagegen Strukturen aufgebaut, die dafür sorgen, dass anderen Menschen geholfen wird.
Ideal sind wir nach dem im Predigttext entworfenen Bild nicht als Gemeinde. Aber auch wir – und damit meine ich alle Gemeinden der Christinnen und Christen in der weltweiten Ökumene – wir lassen uns von den Aposteln unterweisen. Das Angebot ist jeden Sonntag da: sich von Gottes Wort Orientierung und Stärkung geben zu lassen. Wir beten füreinander und miteinander und feiern auch regelmäßig miteinander Abendmahl, wir teilen das Brot. Das alles sind „Erinnerungen“ an die erste Gemeinde der Christusnachfolgenden in Jerusalem.
Lukas zählt zudem in seiner Apostelgeschichte, woraus wir den Predigttext hörten, die vier Kennzeichen einer christlichen Gemeinde auf:
1. in der Lehre des biblischen Wortes bleiben und
2. in der Gemeinschaft handeln und
3. gemeinsam Brotteilen und
4. im Gebet Gemeinschaft erfahren.
Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Das sind die Wesensmerkmale der universalen Kirche geworden. Wo das stattfindet, findet Kirche statt.
Spannend dabei ist, dass das nicht an einen Ort gebunden ist, sondern viel mehr ein Handeln beschrieben wird: Kirche ist dort, wo auf Gottes Wort gehört wird, Gemeinschaft erlebt wird, Brot geteilt, Brot gebrochen wird, Menschen im Gebet verbunden sind.
Also – ideal fing die Geschichte der christlichen Gemeinde an. Sozial gerecht und einmütig.
Stimmt das denn? War es tatsächlich so?
Wir kennen aus den Briefen des Apostel Paulus so viele Konflikte der Gemeinden:
Da hat jemand den anderen finanziell übervorteilt, also betrogen. In einer anderen Gemeinde trafen sich nur noch diejenigen, die begütert waren – und wollten mit den armen Menschen nichts mehr zu tun haben. Dann gab es jede Menge Konkurrenz und Machtkämpfe – wer ist der „Bestimmer“? Wer hat den bessern Glauben? Wer hat die Macht?
Menschliche Geltungsbedürfnisse waren in den christlichen Gemeinden genauso da wie in der nichtchristlichen Welt.
Und trotzdem!
Der Schreiber der Apostelgeschichte beschreibt den Anfang der christlichen Gemeinde als eine ideale Gemeinde. Und vielleicht ist damit gar nicht so sehr eine historische Realität beschrieben, sondern vielmehr eine Idee, wie sich Menschen zueinander verhalten sollten. Sie alle glauben an den auferstandenen Christus, der in seinem Leben – ganz unabhängig von dem Ansehen der Person – in vielen Begegnungen und Gesprächen die Menschenliebe Gottes spürbar werden ließ.
Der Bericht in der Apostelgeschichte über das Leben der ersten Christen ist also vielmehr ein in die Vergangenheit verlegter Zukunftstraum.
Und eine gute Zukunft kann man nur gestalten, wenn es einen guten Anfang gibt.
Das gilt auch für die Geschichten, die von anderen großen Aufbrüchen erzählen, die Menschen in die Freiheit geführt haben: vom Exodus über die Arbeiterbewegung, von der Theologie der Befreiung – auch der feministischen Theologie – bis hin zur großen Friedensvision Europas in der EU.
Auch wenn die Anfänge nie ganz ideal waren – die Geschichten darüber wurden als ideale Anfänge erzählt. Denn die Anfänge unserer Geschichten geben uns Orientierung und Kraft und Verheißung, wohin unsere Wege gehen können.
So ist das ja auch in den Anfangsgeschichten der Bibel.
Die Schöpfungsgeschichte erzählt von den guten Anfängen. Bei jedem Schöpfungswerk Gottes heißt es: „Und Gott sah, dass es gut war.“
Im Johannesevangelium lesen wir eine andere Geschichte eines guten Anfangs:
„Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“
Es gibt keine Welt ohne Gottes Wort, meint Johannes. Und in Gottes Wort gibt es immer wieder Anfänge, weil es am Anfang war.
Auch dieser Bericht von der ersten Gemeinde der Christusnachfolgenden – eine christliche Gemeinde und Kirche hat sich ja erst später gegründet – auch dieser Bericht über ein ideales Zusammenleben der ersten Christen und Christinnen ist so eine Schöpfungsgeschichte, ein guter Anfang! Damit wir ein Bild für eine Orientierung haben, wie es sein sollte.
Die Erinnerung sagt: „Es war einmal“. Weil es einmal so sein soll. Der geglückte Anfang verspricht das glückende Ende. Als Utopie. Einen Ort, den es noch nicht gibt, den wir aber ersehnen.
Weder damals noch heute gibt es die „ideale Gemeinde“. Aber mit dieser Beschreibung aus der Apostelgeschichte haben wir eine Idee, wie Gemeinde sein könnte. Ein schönes Bild, mit dem wir unsere Realität immer wieder abgleichen können, um besser zu werden.
Deswegen regt sich ja zum Glück auch so viel Protest, wenn gerade in Kirchengemeinden zu viel Geld für Luxus ausgegeben wird und zu wenig für soziale Projekte. Weil das so im Gegensatz steht zu dieser Beschreibung: Sie teilten alles, je nachdem wie es einer nötig hatte.
Deswegen sind ja in einer Kirchengemeinde zwar nicht kreative Konflikte, aber zerstörerische Machtauseinandersetzungen so verheerend, weil sie gar nichts mehr davon zeigen, wie eine Gemeinde in Christus einmütig ist. Obwohl es doch der eine Christus ist, nach dem sich alle Christinnen und Christen nennen.
„Diese Geschichte der ersten Gemeinde ist wie die Unruh einer Uhr. Sie treibt unsere Lebensuhr weiter und sagt uns, dass die Zeit des Gelingens noch aussteht und wir noch nicht in dem Land sind, in dem alle in Frieden wohnen können.“ schreibt dazu Fulbert Steffensky (Der Schatz im Acker, S. 80f)
Aber die Sehnsucht danach teilen wir. Sie treibt uns voran. Und sie gibt uns immer wieder Motivation, uns für eine Gemeinde zu engagieren, in der etwas davon zu spüren ist, dass Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und verschiedenen Berufen und Biografien und Prägungen, mit verschiedensten Begabungen und Verletzungen im „Gasthaus Kirche“ genährt werden können.
Lassen wir dieses Bild von „Es war einmal“ in unseren Herzen erstrahlen und als Sehnsuchtsbild bewahren. Lasst uns im Glauben zusammenhalten und die Gemeinde jetzt weiter bauen. Jeder nach dem, was sie und er vermag. Lasst uns gemeinsam feiern und Worte finden, damit weitere Menschen jetzt zu uns finden.
Denn >Jesus sagt: „Jetzt ist die Zeit!“
Wenn Jesus sagt: „Jetzt ist die Zeit!“, dann ruft er zur Veränderung auf, zu mutigen Entscheidungen, die wirklich Veränderung bewirken. Und ja, es gibt sie, die entscheidenden Momente. Und du, du kannst dich entscheiden zwischen richtig und falsch. Das lernen wir doch von Jesus selbst, der sagt: „Jetzt ist die Zeit!“<
So predigte Pastor Quinto Ceasar zum Abschluss des Kirchentages:
Lasst uns handeln und im Geist Gottes füreinander und miteinander Verantwortung übernehmen – das schenke uns die Geisteskraft Gottes. Denn jetzt ist die Zeit!
Amen.
Wem kann man noch trauen? Wem kann man glauben? Viele Menschen und auch mich treiben diese Fragen um. Unsicherheit greift um sich. Lieber nichts tun, als etwas Falsches tun. Misstrauen hat sich breit gemacht wie eine neue Epidemie. Misstrauen gegen „die da oben“. Misstrauen gegen Politiker und Funktionsträger. Gegen die Medien. Gegen die sogenannten Experten. Auch den Kirchen trauen viele nicht mehr so richtig. Ist Gott noch der Vertrauensanker? Wenn ich supergute Tipps für mein Leben und alles Wissen und jede Meinung im Netz finde – warum soll ich dann Gott glauben?
Also: Wem kann, wem soll ich schließlich trauen? Um diese Fragen geht es auch in unserem heutigen Predigttext. Und ich füge noch hinzu: Wem soll ich glauben, an wen soll ich glauben?
Hört dazu den heutigen Predigttext aus dem Buch Jeremia (Jer 23, 16-29) in der Bibelversion „Hoffnung für alle“:
“Hört, was ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage: Achtet nicht auf die Weissagungen dieser Propheten! Sie machen euch falsche Hoffnungen und verkünden euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben, aber nicht meine Worte sind.
Denen, die nichts mehr von mir wissen wollen, verkünden sie in meinem Namen: 'Es wird euch weiterhin gut gehen.' Und zu allen, die bloß ihrem eigensinnigen Herzen folgen, sagen sie: 'Kein Unheil wird euch treffen!‘ Doch keiner dieser Propheten kennt meine geheimen Gedanken, keiner hat mein Wort gehört oder meine Pläne durchschaut. Keiner weiß, was ich gesagt habe.”
Seht, der Zorn des Herrn bricht los wie ein gewaltiger Sturm, wie ein Wirbelsturm fegt er über die Gottlosen hinweg. Er wird sich erst legen, wenn alles ausgeführt ist, was der Herr sich vorgenommen hat.
Die Zeit kommt, in der ihr das klar erkennen werdet! Gott sagt (Predigttext):
"Ich habe diese Propheten nicht gesandt, und doch sind sie losgezogen. Ich habe ihnen keine Botschaft anvertraut, trotzdem haben sie geweissagt. Wenn sie wirklich meine Gedanken kennen würden, dann hätten sie meinem Volk meine Botschaft verkündet, damit es von seinen falschen Wegen umkehrt und aufhört, Böses zu tun. Ich, der Herr, sage: Ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr!
Ich weiß ganz genau, was die Propheten reden: ‘Hört, was euch Gott durch unsere Träume sagen will! ’ Und dann weissagen sie Lügen und berufen sich dabei auf mich! Wie lange soll das noch so weitergehen? Was wollen diese Propheten damit erreichen, dass sie Lügen und selbst erfundene Botschaften verbreiten? Sie denken wohl, wenn sie meinem Volk ihre Träume erzählen, vergisst es mich, so wie seine Vorfahren mich vergessen haben, weil sie dem Götzen Baal dienten!
Ein Prophet, der Träume hat, sollte sagen, dass es nur Träume sind; aber wer mein Wort empfängt, soll es gewissenhaft als mein Wort verkünden.
Meint ihr etwa, Spreu und Weizen seien dasselbe?
Ich, der Herr, sage euch: Mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke schlägt!“
Wenn man Gottes Wort aus Jeremias Mund hört, könnte man fragen: Reiht sich auch Gott ein in die Phalanx der Wutbürger, die ihre Emotionen lautstark und medienwirksam herausschreien? Nein! Denn die Wutbürger treibt die Sorge um, nicht ihren Anteil zu bekommen. Aber Gott hat und ist alles. Und die Bibel kennt auch keinen „Wutgott“. Die Bibel unterscheidet sehr feinsinnig zwischen Wut und Zorn. So redet Jeremia vom Zorn Gottes. Dieser ist nicht das Gegenteil seiner Liebe. Der Zorn Gottes ist die kämpferische Seite seiner Liebe. Gerade weil Gott an der Beziehung zu seinen Menschen so viel gelegen ist, er sie unendlich liebt, richtet sich sein Zorn gegen alles, was dem Menschen schadet und wodurch er sich selbst schadet. Sein Zorn richtet sich hier zuerst gegen die falschen Propheten; erst danach an die von den Propheten getäuschten und beruhigten Zuhörerinnen.
Wir erinnern uns: Die meisten der damals tätigen Propheten sind nicht erwählt. Viele sind ausgebildet in Prophetenschulen, rhetorisch geschickt und darauf bedacht, mit ihrer Rede gutes Geld zu verdienen. Und so reden sie dem Volk und den Herrschern nach dem Munde, sagen, was diese hören wollen, damit diese sich gut fühlen. Sie achten Gottes Gesetze nicht, sie predigen Gottes Wort und Gottes Liebe nicht. Sie predigen Baal, sie sind gottvergessen.
Und auch für Jeremias Zeit gilt zudem: Recht und Gerechtigkeit wurden schändlich missachtet. Das Recht strömte nicht wie Wasser und auch die Gerechtigkeit strömte nicht wie ein nie versiegender Bach. Die Gier der Reichen machte viele arm. Und am Jerusalemer Tempel hatte sich ein wüstes Göttergemisch eingenistet. Vergessen war, dass Gott allein die Ehre gebührt.
All das ist Gott ein Dorn im Auge. Die Hofpropheten verkünden, was ihnen nutzt, und sie ignorieren seine Gebote. Sie beruhigen Gewissen, die nicht beruhigt werden dürfen. Sie lassen die Leute blindwütig weiter ins Verderben laufen und missbrauchen den Namen Gottes. Sie denken, dass Gott zu diesen Zuständen „Ja und Amen“ sagen wird, denn sie glauben nicht mehr ernsthaft an ihn.
Anders Jeremia. Er ruft laut und schrill: „Haltet ein! Besinnt euch! Kehrt um! Nehmt endlich Gottes Gebote wieder ernst. Dann, nur dann habt ihr eine Zukunft.“ So ringt Gott in dieser zornigen Gerichtsrede um sein Volk. Gerade weil ihm sein Volk so am Herzen liegt, zeigt er seine Zornesseite so deutlich.
Und heute? Der Zusammenhalt in der Gesellschaft schwindet. Wir treffen so viele gereizte Menschen, die „gleich auf 180 sind“. Und wir finden überall Angebote, um uns abzulenken. Angebote, die uns das Blaue vom Himmel versprechen und uns sorglos machen wollen. Ablenkungen vom Alltag, die uns für kurze Zeit ein gutes Gefühl machen wollen. Aber eben nur uns Einzelnen, nicht der Gemeinschaft. Egoistisch, nicht liebevoll.
Umso überraschter ist man, wenn man auf einen freundlichen, gelassenen Menschen trifft. Ich bin überzeugt, dass in einer solchen Situation Gott auch um uns ringt. Also lasst euch bitte nicht von diesem vergifteten Klima anstecken! Denkt an Bibelworte, die wie eine Schutzimpfung wirken können, wie zum Beispiel diese pfingstliche Losung: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“. (2. Timotheus 1,7). Diesem Geist sollen wir uns öffnen. Jeden Morgen neu. Unsere Welt wartet auf Menschen, die Gottes Menschenfreundlichkeit verbreiten. Gegen den Konsum, gegen einfache Ablenkung, die uns schließlich nicht hilft. Es soll durch uns an jedem Ort spürbar werden, dass es weiterhin eine christliche Gemeinde gibt. So fragt Gott jede und jeden von uns immer wieder neu: Wes Geistes Kind bist du? Welche Kräfte leben durch dich? Einem Gott, der mit solchen Fragen um uns ringt, dem sind wir ganz gewiss nicht gleichgültig. Diesem Gott können wir unser Vertrauen schenken. Und er warnt uns liebevoll, seine Gebote nicht zu vergessen - nicht hier in der Kirche und vor allem nicht im Alltag.
Einer Frage dürfen wir bei unserem heutigen Predigttext nicht ausweichen: Drohen bei uns Gefahren, bei denen wir als Kirche - wie Jeremia vor 2600 Jahren - warnend und eindringlich die Stimme erheben müssen? Ich sehe in Deutschland und Europa zunehmend unsere Demokratie, dieses kostbare Geschenk, gefährdet. Offensichtlich wollen immer mehr Menschen autoritär beherrscht werden oder sie sehen einfach nicht, was hinter den blinden Lösungen von falschen Propheten steckt. Und – so muss man befürchten – allzu viele wären allzu gerne bereit, selbst mit anzufassen, wenn Menschen vertrieben würden. Und das hat mit Gottes Geboten dann rein gar nicht mehr zu tun!
Bis vor gut zehn Jahren gab es in Deutschland das wirkmächtige Tabu, Rechtsextreme zu wählen. Nur eine kleine Minderheit hielt sich nicht daran. Doch dieses Tabu ist gefallen. Als hätte es in Deutschland den schrecklichen Irrweg des Dritten Reichs nicht gegeben. Hier ist Gefahr im Verzug. Hier steht viel auf dem Spiel. Hier ist unser klares Nein gefragt: Den Rechtsextremen geben wir niemals unser Vertrauen.
Also: Wem können wir noch trauen? Das war eine Ausgangsfrage. Jeremias ganze Geschichte macht uns deutlich: Es lohnt sich, sich auf den nahen und fernen Gott zu verlassen. Er begleitet uns – mal mit Abstand, wenn es läuft - mal näher, wenn es knirscht. Mit ihm können wir Krisen und Erschütterungen durchstehen. Er weiß, wie gefährdet wir sind. Darum hört er nicht auf, um uns zu ringen. Selbst in seinem kämpferischen Zorn zeigt sich seine große Liebe. Und wenn wir nicht falsch prophezeien oder falsch predigen, sondern Gottes Gebote ernst nehmen und bedenken, dann haben wir nichts zu befürchten. Denn er spricht:
“Darum bekommen es diese Propheten mit mir zu tun, sie, die einander die Worte stehlen und behaupten, sie hätten sie von mir! Sie werden mir ganz gewiss nicht entkommen, diese Propheten, die ihre eigenen Gedanken von sich geben und dann sagen: ›Der Herr hat gesprochen.‹
Nein, mir entgehen diese Lügner nicht, die ihre Träume als mein Wort ausgeben! Sie führen mein Volk in die Irre und täuschen es mit ihrer zusammengereimten Botschaft. Ich, der Herr, habe sie nicht gesandt und ihnen keinen Auftrag gegeben. Sie helfen diesem Volk keinen Schritt weiter!”
Und sie helfen den kommenden Generationen auch nicht weiter, sie wollen sie verderben. Und diese Lehre aus der biblischen Geschichte dürfen wir nie vergessen.
Und es gab noch diese zweite Frage:
Wem soll ich glauben, an wen soll ich glauben? Ganz einfach:
“Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand.” Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: “Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.” Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. - Amen!
frei stehend im Altarraum
Liebe Gemeinde,
Predigttext und Teile der übrigen Lesungstexte sind heute Bestandteile meiner Predigt. Die Apostelgeschichte gilt als Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Lukas weiß, dass das Heilsgeschehen, wie es in den Schriften des Alten Testaments vorausgesagt wurde, keineswegs mit dem Tod und der Auferstehung Jesu aufhört, sondern in der weltweiten Verkündigung der Christusbotschaft weitergeht. Und so treffen wir in der Apostelgeschichte im 8. Kapitel auf den Diakon Philippus, der durch Gott geschickt wird, die erste Taufe eines Heiden durchzuführen. Hören wir gespannt zu – ihr dürft sitzenbleiben.
Der Kämmerer aus Äthiopien
26-39 Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen! Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese (Jesaja 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.« Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist.« Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr; er zog aber seine Straße fröhlich.
Am Ambo:
Liebe Gemeinde,
wir hörten gerade die Lesung und gleichzeitig Predigttext aus dem Neuen Testament. Es ist die Geschichte von der ersten bezeugten Taufe eines Nicht-Juden. Sie kommt kurz und knackig daher: Der Kämmerer kam aus Jerusalem. Er las im Buch Jesaja und verstand den Text nicht wirklich. Der Diakon Philippus – nicht der Jünger und Apostel Philippus – wird von Gott geschickt, erklärte ihm das Prophetenwort und predigte das Evangelium von Jesus. Dann taufte er ihn und der Kämmerer fuhr fröhlich weiter. Kurz und knapp. Ratz fatz fertig. Eine schnelle Drop-In-Taufe, wie sie in Hanau, Hamburg und Skandinavien heutzutage regelmäßig angeboten wird.
Ich fragte mich immer: was soll das? Das hört sich an wie Magie und ein bisschen Zauberei. Und das glaubte ich so nicht. Irgendetwas stimmte für mich da nicht. Zu einfach. Zu schön. Zu flach. Zu glatt. Zu einfältig. Warum lässt sich ein Kämmerer, der alles hat und aller Sorgen ledig ist, nach einigen Erklärungen direkt taufen? War Philippus so ein begnadeter Redner und Glaubensvertreter, fast schon Glaubensverkäufer, dass er sofort den Vertrag abschließen konnte? Was passierte da wirklich?
Hier kommen meine Ergänzung zu dieser kurzen Begebenheit, die so klein daherkommt, aber eine erstaunliche Größe und Weite hat. Es ist ein langer Weg! Geht ihn mit mir!
Hinten in der Kirche; langes Seil das während des Vortrags ausgelegt wird bis in den Altarraum. Es symbolisiert die lange Wegstrecke Meroe > Kairo > Jerusalem. Am Schluss der Geschichte wird der letzte Seilrest bis zum Taufbecken ausgelegt.
Es ist Urlaubszeit, Reisezeit. Ich nehme euch heute mit auf die lange Reise zur ersten Taufe. Sie beginnt in dem fernen Land Nubien – dieses ist tatsächlich mit der Bezeichnung „Äthiopien“ gemeint. Nubien ist das heutige Sudan. Meroe war die Hauptstadt Nubiens zu der Zeit, zu der die Geschichte spielt. Meroe gibt es heute noch. Lasst uns annehmen, der Kämmerer der Kandake sei dort aufgebrochen. Von Meroe nach Jerusalem sind es mehr als 2.900 Kilometer Wegstrecke: über den Nil mit vielen Katarakten und Stromschnellen. An Memphis vorbei nach Kairo und dann weiter über Port Said und den Küstenstreifen am Mittelmeer oder per Boot bis Gaza und von dort weiter bis nach Jerusalem. Beschwerlich, gefährlich. Nicht, weil er zu Fuß gehen musste oder arm war. Gefährlich, weil die vielen Stromschnellen und Katarakte zu überwinden waren, Naturgewalten sowie kleine und große wilde Tiere drohten und der Kämmerer schwarze Hautfarbe hatte und in Gebiete reiste, in denen er mindestens ein Exot war, jedenfalls auf den ersten Blick nicht unbedingt willkommen.
Also warum nahm er die Strapazen auf sich, auch wenn er Diener dabeihatte, die ihm die meiste Last abnahmen? Er war Kämmerer, einer der höchsten Beamten im Staate und direkt der Königin – der Kandake – unterstellt. Einer Königin, die eine jahrhundertealte Tradition pflegte und bewahrte. Die Tradition bestand religiös in einer Variante des jüdischen Glaubens an einen Gott. Eher mündlich überliefert und ritualisiert. So fuhr der Kämmerer sicherlich auch im Auftrag seiner Königin nach Jerusalem, um im Herzen des Glaubens mit eigenen Augen den Tempel zu sehen und gute Kontakte mit Jerusalem und seiner religiösen Oberschicht aufzubauen. Auf Augenhöhe. Internationale Diplomatie sozusagen.
Was gibt es noch zu dem reisenden Staatsbeamten zu sagen? Luther übersetzt das Ursprungswort mit „Kämmerer“. Die korrekte Übersetzung bedeutet, dass er ein „Eunuch“ ist. Er ist verschnitten. Kastriert und zeugungsunfähig. Das war nicht ungewöhnlich für einen Hofbeamten in afrikanischen, orientalischen und asiatischen Reichen. Es wird aber noch wichtig für seinen Besuch in Jerusalem. Und nebenbei: Geld spielte für ihn mit absoluter Sicherheit keine Rolle. Er konnte alles kaufen, was er wollte, und genoss höchstes Ansehen in seinem Herrschaftsbereich.
Also: dieser hochgestellte Mann macht sich auf seine Pilgerfahrt im Namen seiner Majestät. Er ist mindestens zwei Monate auf dem Nil unterwegs von Meroe bis nach Kairo – und dann noch 2 bis drei Wochen von Kairo bis nach Jerusalem. Nach mindestens zehn Wochen Reisezeit checkt er dort im besten Hotel am Platz ein, entspannt sich einige Tage und bereitet sich dabei auf seine diplomatische Mission und seinen Besuch im höchsten Heiligtum – dem Tempel in Jerusalem – vor. Er ist bester Stimmung und zieht mit seinen Dienern zum Tempel. Das fällt selbst in einer Stadt wie Jerusalem auf, da alle Menschen dieser Abordnung schwarze Hautfarbe haben und standesgemäß bunte und aufwändige Kleidung tragen.
Voller Vorfreude und positiver Spannung klopft er an die Tempeltür und bittet um Einlass, um endlich seinen Glauben am Originalschauplatz im Originaltempel leben zu dürfen; um zu beten und zu opfern. Um Gott ganz nahe zu sein und ihm für seine bisherige Reise zu danken. Um den höchsten Hohepriestern seine Aufwartung machen zu dürfen. Um diplomatische Kontakte zu knüpfen. Er will nun seinen Job machen und freut sich darauf, standesgemäß empfangen zu werden.
Er klopft. Nach einiger Zeit kommt ein Tempelwächter, sieht ihn an und sagt: „Du? Schwarzer Proselyt? Du kommst hier nicht rein! Egal, was du bist und wieviel Geld du hast! Du bist verschnitten! Nach dem 5. Buch Mose darfst du nicht in die Gemeinde kommen. Du kannst kein Jude sein. Du kannst hier nicht beten, du kannst hier nicht opfern, du kannst hier nicht zugehören! Du kannst unseren Gott hier nicht finden! Wenn du sagst, unser Gott sei auch dein Gott, dann kann das in dieser unserer Welt nicht zusammenkommen. Geh! Geh sofort! Fort mit dir und deinen dunklen und viel zu bunten Brüdern!“ Und der Hohepriester schlägt die Tür endgültig zu.
Am Ambo:
Das ist ein brutaler Niederschlag, ein unmittelbarer K.O. in der ersten Runde, eine Scheitern auf der ganzen Linie. Alle Hoffnung, alle Wünsche, alle guten Absichten zerfallen augenblicklich zu Staub, lösen sich auf, verwehen wie dünner Nebel. Die Grundfesten seines Glaubens sind zerstört. Ein hergelaufener, niedriger Torwächter sagt ihm, er gehöre nicht mehr dazu, gehörte niemals dazu? Er und damit auch sein ganzes Volk? Sein Glaube ein einziger Lug und Trug? Sein Selbstbewusstsein verdampft wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber er muss Haltung bewahren. Darf sein Gesicht gegenüber seinen Dienern nicht verlieren. Und was soll er seiner Königin, der Kandake sagen? Dafür hat er nicht für drei Monate die gefährliche Reise auf sich genommen! Wie soll sein Volk weiter glauben können, wenn nicht mal er vorgelassen wurde ins Heiligtum? Fragen über Fragen, Zweifel, Orientierungslosigkeit. So kann doch Gott nicht sein, an den er sein Leben lang innig glaubte. So kann doch Gottes Liebe nicht aussehen. Oder hat er sich in allem getäuscht? Irgendwo musste es eine Erklärung geben. Er musste einfach mehr wissen. Er musste überprüfen, was wirklich geschrieben ist von seinem Gott. Also begann er mit der Recherche. Er ging am Folgetag wieder los und suchte in Jerusalem nach Schriften über Gott. Auch wenn die sehr teuer waren, Geld hatte er genug. Er wollte wissen und er würde Wissen finden. Er ging auf den Markt, dort wo die Abschriften der wichtigsten Bücher gehandelt wurden. Er schaute sich um und schließlich fand er einen Händler mit ansprechender Ware. Er suchte, prüfte und kaufte schließlich eine dicke Rolle mit dem gesamten Buch Jesaja. Er hatte gehört, dass dies das wichtigste und meistgelesene Buch nach der Tora war. Geschrieben von einem hoch angesehenen Propheten, auch wenn dieser bei Konservativen umstritten und nicht beliebt war. Daneben kaufte er noch einige weitere Rollen und Papyri, die ihm gut und wichtig erschienen.
So ausgestattet ging er wieder in seine noble Herberge und las die heiligen Schriften, vor allem Jesaja. So kam er auch zu dieser Stelle und las:
3-7 Und der Fremde, der sich dem HERRN zugewandt hat, soll nicht sagen: Der HERR wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen: Siehe, ich bin ein dürrer Baum. ... Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Und die Fremden, die sich dem HERRN zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, ... alle, die den Sabbat halten, ... und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus, ... denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker.
Das las er – Schwarz auf Weiß stand es hier. Galt den Gottes Wort aus Jesajas Mund nicht? Dieser Text ist doch seit 700 Jahren bekannt und das Bethaus, also der Tempel stand hiernach allen Völkern und auch ihm als Eunuchen offen! Dennoch wurde er nicht vorgelassen, kam nicht einmal durch das erste Tor des Tempels! Jesaja hat dies 800 Jahre nach Mose verkündet, aber es wurde hier nicht anerkannt. Kein Durchkommen bei diesen konservativen und machthungrigen Leviten und Pharisäern, die nur Mose gelten ließen.
Einige Tage nach dieser tiefen Enttäuschung machte er sich auf den Rückweg. Er wusste noch nicht, was er seiner Königin sagen sollte, wie er ihr dieses Scheitern auf ganzer Linie, diesen tiefen Glaubensverlust erklären sollte, der die Grundfesten des Glaubens seines Volkes erschütterte.
So verließ er tief in Gedanken versunken Jerusalem in Richtung Heimat. Aber er wollte von Gott nicht lassen, er wollte wissen, um glauben zu können. Also las er. Er las weiter in der Schriftrolle des Propheten Jesaja. Ihm fiel es immer leichter, die Schriftzeichen zu entziffern und die Worte zu übersetzen, aber der Sinn der Worte wollte sich ihm nicht immer erschließen. Was sagte und prophezeite Jesaja nun wirklich, was bedeuteten die Worte Gottes? Was sollte und was konnte er glauben, wenn doch die Hohepriester in Jerusalem alles ablehnten, was er und was an ihm war? Wo war in diesem allem Gott, den er so sehr liebte? Er war voller Zweifel, zutiefst verunsichert und gleichzeitig voller Sehnsucht nach seinem Gott.
So las er auch diese Stelle im Buch Jesaja:
13-15: Siehe, meinem Knecht wird’s gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. ... So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie nie gehört haben, nun erfahren.
Er blätterte zurück und murmelte zum wiederholten Male diese Worte aus der Schriftrolle:
(Jesaja 53,7-8): Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen.
Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des HERRN Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben.
Sterben und leben gleichzeitig? Wie geht das? Da nahm er den Mann wahr, der so plötzlich erschienen war und schon eine ganze Weile neben seiner Kutsche ging. Unvermittelt fragte der Mann: „Verstehst du überhaupt, was du da liest?“ Er antwortete: „Nein, nicht wirklich. Die Worte erklären sich mir nicht. Ich brauche Hilfe und Anleitung.“ Er fragte den Mann: „Kannst du mich anleiten und mir die Worte erklären?“ Und so erklärte ihm der Diakon Philippus die Worte des Jesaja und erzählte ihm vom Leben und Wirken, dem Leiden, dem Tod und der Auferstehung Jesu‘.
Daraufhin zeigte sich plötzlich dem Kämmerer eine neue Welt, eine neue Sichtweise, ein neuer Glaube. Er sah Gott im Lichte des Jesaja und im Lichte von Jesus. Von Liebe, Gleichberechtigung, Völkerverbindung. Er sah den Friedensgott, den Gott, der umarmt und keinen Unterschied macht nach Hautfarbe, Geschlecht oder Zeugungsfähigkeit. Das war der Gott, den er suchte, der Gott, der ihn mochte, den er mochte. Er sagte zu Philippus: „Wenn Jesus von Johannes getauft wurde und wenn Jesus sagte: „Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe!“, dann will ich nun auch getauft werden und Jünger Jesu sein.
Da ist ja ein kleiner Tümpel!
Philippus, taufe mich.“
Am Taufbecken Rest des Seils auslegen
Und er ließ sich taufen. Ein Eunuch. Ein Schwarzer. Ein Ausländer. Nun vereint in der großen Gemeinde der Menschenkinder getauft in Jesu Namen. Und nach den vielen Enttäuschungen und Zweifeln ist er wieder befreit im neuen Glauben, voller Zuversicht und voller Freude. Und daher kann er fröhlich nach Hause fahren.
Das ist die lange Geschichte hinter der kleinen Passage aus der Apostelgeschichte. Abgelehnt und ausgestoßen von der alten Gemeinde – enttäuscht von der Hartherzigkeit der Vertreter des alten Glaubens – nun getauft und aufgenommen in die weltumschließende Christengemeinschaft.
So wurde die kurze Geschichte der Drop-In-Taufe zu einer langen Geschichte über Glaubenssehnsucht, Glaubensenttäuschung, über Glaubenszweifel und Glaubenssuche. Der lange Weg führte hin zur Liebe und zum Frieden eines neuen, des christlichen Glaubens in der Nächstenliebe – ohne Hierarchie, ohne Status, ohne Dünkel. Tief gegründet im Alten Testament und fortgeschrieben im Neuen Testament:
Gottes ewige und unverbrüchliche Liebe zu den Menschen.
So soll uns diese Geschichte erinnern: gib das Suchen nach Gott nicht auf, auch wenn du enttäuscht wurdest von Menschen. Gott sieht dich. In der Taufe bist du aufgenommen in diesen großen Kreis der Liebenden. Und daran erinnern wir uns heute. An diese Zuversicht, die uns die Taufe gibt:
Gott kennt dich bei deinem Namen und gibt dich nicht mehr auf.
Übrigens: der Kämmerer zog weiter und verbreitete den christlichen Glauben schließlich in seinem Land, in Südarabien und in Ceylon. Bis heute führt sich die Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche auf den Eunuchen zurück.
Amen!
Und der Friede Gottes, der höher und umfassender ist, als wir es uns vorstellen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen!
Liebe Gemeinde,
angesichts der Lage in Israel, in Gaza und dem Westjordanland nach dem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober 2023 und den Entwicklungen der vergangenen 10 Monate fällt es mir schwer, am heutigen Israel-Sonntag fröhlich zu predigen. In Folge der ungezügelten Antwort der Regierenden im Staate Israel sind Juden weltweit und auch wieder in Deutschland einer Welle von antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Viele machen sie verantwortlich für die Politik und Kriegsführung der gegenwärtigen israelischen Regierung. Aber das ist unangemessen und grundlegend falsch!
Was die Jüdinnen und Juden bei uns dennoch ängstigt – und was auch uns ängstigen sollte –, sind die ständigen Angriffe auf den Bestand des Staates Israel, auf sein Existenzrecht. Von daher ist es gut und wichtig, wenn in dem Gottesdienst am Israelsonntag in besonderer Weise das grundlegende und nicht infrage zu stellende Verbindende von Judentum und Christentum zum Ausdruck kommt.
Wenn Jüdinnen und Juden antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt sind, dann ist das für uns nicht hinnehmbar. Denn es ist auch für uns ein Angriff auf das, was Judentum und Christentum untrennbar miteinander verbindet. Ein Angriff auf die Wurzeln des Christentums, die tief im Alten Testament gründen. Denn ohne diese wären Jesu Worte nur tönendes Erz und wir verdorrten wie Jonas‘ Rizinusstrauch bei Ninive.
So steht der heutige Predigttext sowohl im Tanach als auch im Alten Testament.
Wir hören den Propheten Sacharja aus dem achten Kapitel die Verse 20–23 nach der Übersetzung der Zürcher Bibel:
20 So spricht der Herr der Heerscharen: Es werden noch Völker kommen und Bewohner vieler Städte.
21 Und die Bewohner der einen werden zur anderen gehen und sagen: Lasst uns hingehen, um das Angesicht des Herrn zu besänftigen und um den Herrn der Heerscharen zu suchen! Auch ich will gehen!
22 Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und um das Angesicht des Herrn zu besänftigen.
23 So spricht der Herr der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden zehn Männer zugreifen aus allen Sprachen der Nationen, sie ergreifen den Saum eines Judäers und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört: Gott ist bei euch!
Der Judäer, der eine Jehudi ist immer wieder christologisch verstanden und gedeutet worden. Christologisch bedeutet in dieser Hinsicht, dass überall im Alten Testament nach Hinweisen auf den Messias gesucht wird. Im Judäer des Predigttextes Jesus erkennen zu wollen, ist eine Sicht, die oberflächlich betrachtet vielleicht offensichtlich scheint. Aber bereits Martin Luther war in dieser Hinsicht sehr viel zurückhaltender:
»Diesen spruch haben etliche auff Christus zeit gedeutet. .... Das ist eine gute meynunge, Aber an diesem ort dunckt sie mich nicht eben fein.«
Der augenfällige christologische Ansatz greift hier also nach überwiegender Meinung zu kurz. Der Judäer steht vielmehr in diesem Zusammenhang sinnbildlich für das ganze Volk Israel.
Aber wie ist dann der Predigttext zu verstehen? Ich will euch dafür unterschiedliche Perspektiven aufzeigen.
Zuerst diese:
Die Verse 20 – 23, die wir hörten und als eine Einheit erscheinen, sind tatsächlich zwei Abschnitte. Das erste Gottes-Wort der Verse 20-22 ist ein poetisch durchgeformtes Gedicht aus drei Strophen. Dieses „Völkerwallfahrtsgedicht“ entwirft eine universale Friedensvision, in der die Gegensätzlichkeit und Feindschaft zwischen Israel und den Völkern ein für alle Mal überwunden sein wird. So schreibt es Professor Dr. Rüdiger Lux in der Handreichung zum heutigen Tag.
Heute könnte das Völkerwallfahrtslied etwa so klingen:
Gott spricht:
Glaube fest daran, dass Völker kommen,
Bewohner aus ungezählten Städten.
Sie gehen gemeinsam von Stadt zu Stadt
und sie sprechen und sagen und reden:
Lasst alles stehen und lasst uns gehen,
um das schöne Angesicht Zebaots zu sehen.
Lasst uns um Gnade beten, rufen, flehen
Geht hin zu Gott – auch ich will gehen.
Denn viele Völker werden kommen – ungezählt
starke Nationen, große Staaten, alle Welt,
um in Jerusalem Gott Zebaot zu schauen
und sie versprechen fest: Ich will nur dir vertrauen!
Wenn dies eintrifft, dann herrscht völkerverbindend Liebe und Frieden zwischen allen Nationen im Namen des einen Gottes Zebaot.
Das zweite Gottes-Wort ist eine kurze Erzählung. Diese „Mantelgeschichte“ führt uns ans Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Die Großmacht Babylon wurde von der neuen Großmacht Persien besiegt und ersetzt. Davon profitierten die im Exil befindlichen Israeliten, denn sie durften in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren und dort ein neues Gemeinwesen und ihren Tempel wieder aufbauen. In Israels Geschichte ist dies eine grundlegende „Zeitenwende“. Die Rückkehr der Exilierten bedeutete die Wiedervereinigung nach einer langen Zeit der Trennung: Wiedervereinigung eines aufgeteilten Volkes, Wiedervereinigung mit dem Heimatland und auch Wiedervereinigung mit dem Gott Israels. Ein großer geschichtlicher Augenblick, der den Weg zu Heilung und Versöhnung eröffnete.
Die Hinwendung und Orientierung zu dem Gott auf dem Zion, so lautet die Botschaft des Propheten Sacharja, der übrigens übersetzt „Gott erinnert sich“ bedeutet, ist der Schlüssel zur Überwindung der Gegensätze innerhalb Israels und außerhalb im Verhältnis zu anderen Staaten. Denn Gott erinnert sich an sein auserwähltes Volk und Israel erinnert sich intensiv an Gott.
Das Bemerkenswerte an der Zukunftsperspektive, die Sacharja insgesamt entwirft, ist nun dies:
Israel muss sich seiner eigenen Vergangenheit erinnern, mit all den Irrwegen und Abgründen, die zum Exil führten. Israel muss seine eigene Vergangenheit akzeptieren und beten und fasten, um erneut die Sendung ausfüllen zu können, zu der es berufen ist: nämlich die Völkerwelt zu inspirieren und zu einem Mittler des Glaubens zu werden. Israel wird zu einem Modell für ein Volk, das sich an Gottes Willen, seiner Gerechtigkeit und Barmherzigkeit orientiert. Und das bedeutet für die „Völker und Nationen“: Nur indem sie sich diesem Modell anschließen, werden sie befreit von dem Wahn, die eigene Bestimmung und Identität im Blut und Boden oder in Siegen und Niederlagen oder in Sprache, Kultur, Nation sehen zu müssen.
Der Prophet entwirft eine Vision, die sich wie eine spirituelle Alternative zur Gründung der Vereinten Nationen anhört: „Zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Saum seines Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist.“
Dem Mantelsaum des judäischen Mannes kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu, weil er jeglichen nationalistischen und chauvinistischen Gegensätzen entgegenwirkt, diese aufhebt und in die Zeit hineinführt, in der „Schwerter zu Pflugscharen“ gemacht werden und „Spieße zu Sicheln“, wie es 200 Jahre zuvor der Prophet Micha 4,3 verkündete. Wer diesen Mantelsaum fest ergreift, hat keine Hände mehr frei, um Waffen zu führen.
Ich möchte noch eine dritte für mich überraschend frische, neue und unverkrampfte jüdische Perspektive von Alexander Grodensky, Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde Luxemburgs und Berater des Vorstandes der „Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum“ vorstellen.
Er kommt zu der Einsicht, dass „jehudi in diesem Kontext ein Mensch genannt wird, der sich zu Gottes Einigkeit – jichud - bekennt“. Er stellt die Fragen:
„Ist Gott wirklich nur in Jerusalem zu finden? War Gott jemals nur in Jerusalem?“ und antwortet sofort: „Wenn wir glauben, dass Gott ein immaterielles Wesen, die Seele der Welt ist, dass die Gottespräsenz allumfassend ist, dann ... hängt (es) nicht von der Geografie ab. Dann ist „Jerusalem“ nicht nur eine Stadt, dann ist Jerusalem ein universelles Symbol für Geschwisterlichkeit und Frieden. ... In diesem Sinne kann man die Erwähnung von Jerusalem so verstehen, dass die Völker gemeinsam mit Israel zur Anerkennung Gottes kommen werden, sodass die Verwirklichung der Ideale der Geschwisterlichkeit und des Friedens möglich wird. Dabei steht der Mensch im Fokus, nicht ein geographischer Ort.“
Dazu wollen alle mit Israel den Weg der göttlichen Lehre gemeinsam gehen, um göttliche Werte in der Welt zu verwirklichen. Wird hier suggeriert, dass die Völker das Judentum annehmen, oder, zutreffender, dass das Judentum zu einer allumfassenden Weltreligion wird, seine ethnische Bindung verliert und eine Art Vernunftreligion wird? Der Abschnitt lässt viele dieser Fragen offen.
Weiterhin führt Rabbi Grodensky aus:
„Es heißt aktuell oft: „Es gibt keine Beziehung zum Gott Israels am Volk Israel vorbei.“ Was bedeutet dabei „Gott Israels“ im heutigen, nicht religions-geschichtlichen Kontext? Als Jude glaube ich an Gott, nicht an eine nationale Gottheit. Ich sehe auch keinen Grund zur Annahme, dass eine Beziehung zu Gott über Juden bzw. das Judentum laufen soll. Daher finde ich die Deutung von „Judäer“ im V. 23 heute „als Monotheist“ treffender.“
Folgen wir diesem Gedanken, kann man die Definition „Israel“ bzw. „Judäer“ erweitern, und zwar auf alle Menschen, die sich mit dem Göttlichen im Monotheismus und dem Prozess der Vervollkommnung identifizieren. Da sich jede und jeder mit dem zur Erlösung führenden Prozess identifizieren kann, kann somit auch jede und jeder zum „Volk Israel“ gehören oder israelähnlich sein. Dabei wird auf die funktionelle Bedeutung von „Israel“ hingewiesen als Träger des Monotheismus, nicht auf die kulturelle Identität, die jüdische Gemeinschaft.“
Soweit Rabbiner Alexander Grodensky.
So übertrage ich den Text und passe ihn auf diese Interpretation und die Jetztzeit an:
„Und Gott spricht: In jenen Tagen wird ein Volk, das sich zu mir bekennt, meinen Mantel des Schutzes und Heils, der Bewahrung und Zuversicht tragen und viele Völker werden den Saum des Mantels ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört: Gott ist bei euch!“
Das Christentum hielt und hält diesen Mantelsaum fest im Griff. Diese Einsicht wollen wir uns gerade am heutigen Israelsonntag bewusst machen.
Wenn der ‘Isch Jehudi‘, das von Gott auserwählte Volk Israel als Mantelträger verschwinden würde und dann niemand mehr als zentrale Basis den Mantel des Schutzes und Heils, der Bewahrung und Zuversicht Gottes trüge, fiele der Mantel einfach in sich zusammen und verginge. Beten wir also für die Jüdinnen und Juden und auch für alle, die den Mantelsaum fest im Griff haben, dass der Staat Israel seine Rolle als Bewahrer des auserwählten Volkes klug, weise und mit Liebe zu Gott und allen Nächsten ausfüllt, um Schaden abzuwenden.
Lasst uns wachsam sein und aktiv werden, wenn Jüdinnen und Juden und Israel in Gefahr geraten, sei es durch äußere Gewalt oder sei es auch durch inneres, staatsinternes gottes- und menschenverachtendes Handeln. Christlich aktiv gegen alle Rassisten, Extremisten, Terroristen, Nationalisten, Chauvinisten, Dogmatiker, falschen Propheten und machtbesessenen Politiker, denn sie sind gefährlich – immer und überall – zu jeder Zeit – in jedem Land!
Vor ihnen bewahre uns Gott und gebe uns Kraft!
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!
Amen!
Liebe Gemeinde, ich eröffne heute mal mit einer vielleicht überraschenden Frage: Seid ihr glücklich?
Glück! Glück? Gehört Glück in die Kirche? Das Wort „Glück“ erscheint wie oft im Neuen Testament? Genau 0 mal! Gar nicht! Kennen Christen kein Glück? Ist Glück für Christen nicht vorgesehen? Müssen wir immer in Gedenken an das Ostergeschehen geduckt, gebeugt, an unsere Sündhaftigkeit denkend still durch die Welt ziehen?
Denn schließlich steht im Zentrum unseres Glaubens das Kreuz, an dem Jesus starb. Ausgerechnet im Tod Jesu schenkt Gott uns Heil und Rettung. Das ist alles ein sehr ernstes Geschehen, denn es hat mit unserer Gottesferne und Sünde zu tun. Sich unbeschwert am eigenen Glück zu freuen, scheint keinen Platz zu haben, wenn unser ganzes Leben – wie Martin Luther sagte – eine fortwährende Buße ist.
Und doch gibt es glücklicherweise auch in der Bibel Abschnitte, die von nichts anderem als vom Glück erzählen. Ja, glücklich sein: Das dürfen wir wirklich – ohne schlechtes Gewissen und selbst dann, wenn vielleicht andere gerade nicht so glücklich wie wir sind. Wir müssen auch nicht gleich im Hinterkopf haben, dass das Glück ja nie von Dauer ist und leicht zerbrechen kann. Das Glück annehmen und genießen – das geht! Und darum geht es!
Wie das möglich ist, erzählt uns Psalm 16, der heutige Predigttext:
Psalm 16 – Textversion Bibel „Hoffnung für Alle“
Du bist mein ganzes Glück!
Ein Lied von David.
Beschütze mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht!
Ich bekenne: Du bist mein Herr und mein ganzes Glück!
Darum freue ich mich über alle, die zu dir gehören. Sie bedeuten mir mehr als alle anderen in diesem Land!
Wer sich aber von dem lebendigen Gott abwendet und anderen Göttern nachläuft, der kommt aus dem Kummer nicht mehr heraus.
Diesen Göttern will ich kein Opfer bringen, nicht einmal ihre Namen nehme ich in den Mund.
Du, Herr, bist alles, was ich habe; du gibst mir, was ich zum Leben brauche.
In deiner Hand liegt meine Zukunft. Ich darf ein wunderbares Erbe von dir empfangen, ja, was du mir zuteilst, gefällt mir.
Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt.
Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle.
Darüber freue ich mich von ganzem Herzen, alles in mir bricht in Jubel aus. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit.
Denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen und mich nicht der Verwesung preisgeben, ich gehöre ja zu dir.
Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück.
Der Psalm handelt tatsächlich vom Glück: ganz konkret und fast selbstverständlich. Der Psalm weiß auch um die Gefährdungen. Er kennt die Bedrohungen, denen unser Leben ausgesetzt ist. Aber er schiebt sie nicht gleich in den Vordergrund, sodass sie alles verdunkeln. Nein, in seinen Worten drückt sich vollkommenes Glück aus.
Und doch: er unterscheidet er sich von all den Ratgebern in den Buchläden, die viel von Selbstverbesserung und Selbstertüchtigung reden und uns dadurch unter Druck setzen, das Glück des Lebens zu erreichen. Er nennt nicht Geld, materiellen Reichtum oder bedingungslose Selbstverwirklichung. Er weiß, dass wir Menschen dieses Glück nicht allein aus eigener Kraft erzwingen und für uns festhalten können. Und noch in einer anderen Hinsicht unterscheidet er sich von der Ratgeberliteratur: Er setzt unser Glück zu Gott in Beziehung! Beide gehören zusammen: Gott und Glück!
Einerseits: Wenn es uns schlecht geht, kommt Gott öfters in Spiel: „Womit habe ich das verdient? Warum lässt Gott das zu?“, lautet dann der Vorwurf.
Andererseits: Wenn es uns gutgeht, wenn wir unbeschwert glücklich sind, fragen wir weniger, warum Gott unser Glück zulässt.
Wir trennen das Glück, das uns zuteilwird, von Gott: Darin liegt der entscheidende Fehler! Oder wir bringen anderen Göttern Opfer und meinen dadurch Glück zu finden. Wir opfern ihnen Zeit und Identität, beschäftigen uns mit ihren falschen Versprechungen von Selbstverwirklichung oder einfachen Lebenslösungen. Aber nicht einmal ihre politischen Namen und Socialmedia-Bezeichnungen, die vergiftenden Kummer verursachen, nehme ich in den Mund!
Denn es ist nur Gott, dem wir unser Leben mit all seinen Möglichkeiten verdanken. Um es in den Worten unseres Psalms zu sagen: Er berät uns, er stützt uns, er sorgt für uns, er bewahrt uns, er zeigt uns den Weg zum Leben. All das ist auch bei uns von manchen persönlichen Erfahrungen gedeckt. Es hat sich oft bewahrheitet: in Zeiten etwa, als wir unsicher waren, aber eine wichtige Entscheidung zu treffen hatten, die sich hinterher als richtig erwies. Zum Glück: Ja! Oder als wir in einen Autounfall gerieten, aber unverletzt blieben. Nur Blechschaden. Glück gehabt und einen Schutzengel: Ja! In schwierigen Lebensphasen, wenn wir neue Wege gehen müssen. Ja! Hinter allem stand der liebende Gott, der spürbar seine Flügel über uns gebreitet hatte. Der uns Hoffnung schöpfen ließ. Ja!
Solche Erfahrungen von Momenten oder Zeiten des Glücks können zu einer großen Dankbarkeit gegenüber Gott führen: „Du bist immer für mich da, lieber Gott. Vielen Dank dafür!“ Das bedeutet nicht, dass wir ständig auf der Sonnenseite leben. Wir bleiben von Krankheiten bedroht und sind Gefahren ausgesetzt. Und wir trauern über den Tod von Menschen, die wir liebten oder die uns etwas bedeuteten. Aber es tröstet uns, dass wir auch beim Gang durch finstere Täler in Gott geborgen sind und uns von ihm geführt wissen. Wenn Gott Trost und Halt gibt. In diesem Zusammenhang steht unser heutiger Psalm in der Psalmengruppe: er ist als Ausdruck höchster diesseitiger Lebensfreude und größten Glückes zu verstehen. Es ist eine Lebensfreude, die in der Gewissheit gründet, dass die wichtigste Gabe an den Beter Gott selbst ist, seine Nähe, seine Leitung. Andere Psalmen der Gruppe verweisen auf den Weg durch das dunkle Tal (Ps 23,4), auf die Erfahrung von Gewalt (Ps 17,9–12), auf Krankheit und Schwäche (Ps 22,15–18). Das mag lebensnäher klingen als Ps 16 es formuliert. Doch es zeichnet Ps 16 aus, dass er zeigt, wie es sein sollte. Er vertröstet nicht auf Zukunft hin. Und so schaut das betende Ich auf Gott, der ein Leben in seiner Nähe zusagt, ein Leben der übergroßen Freude und des Glückes. Es ist ein Glück, Gott vertrauen zu können und seine Nähe zu fühlen! Dabei ist Gott kein Mediziner oder Meteorologe oder Paartherapeut. Er ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Aber er ist ein Ratgeber und Schützer und Ermöglicher. Dankbar greife ich den Hinweis aus dem Psalm auf, dass in der Nacht – in den Nieren, tief im Inneren, wie es im Originaltext heißt – Konflikte zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und mir ausgetragen werden. Entscheidungen liegen nicht im Lichte des Tages auf der Hand, sondern müssen im nächtlichen Kampf oftmals errungen werden. Ich, ich als Mensch, bin aktiv und intensiv beteiligt, wenn ich um Entscheidungen ringe. Dabei setze ich Gott vor mich und entscheide damit, wer mich beraten, mir zur Seite stehen darf. Genau darum wanke ich nicht. Er setzt mich in Bewegung und lässt mich die Widrigkeiten aushalten und vor allem: er lässt mich anderen helfen und andere mir helfen. Gott setzt uns in Bewegung und lässt uns die Widrigkeiten aushalten und vor allem: er lässt uns anderen helfen und andere uns helfen.
So wächst in uns eine starke Zuversicht, die selbst über unseren Tod hinausreicht. „Gibt es noch Hoffnung?“, lautet manchmal die verzweifelte Frage von Menschen, die schwer erkrankt sind, an ihre Ärztinnen oder Ärzte.
Ja, liebe Gemeinde, es gibt Hoffnung! Solange wir leben, kann Gott uns seine Liebe zeigen und uns heilen. Er gibt uns die Kraft, es auszuhalten, zu bewältigen, sprachfähig zu bleiben. Wir können dieses Glück wirklich erfahren. Und die Hoffnung auf Gottes Macht endet nicht an den Grenzen unseres Lebens: „Du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen“, sagt unser Psalm. Wenn wir in dieser Welt unser Glück aus der lebendigen Beziehung zu Gott empfangen, dürfen wir auch auf ein ewiges Glück hoffen. Das verheißt er uns in der Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich – einer Gemeinschaft, die nie mehr enden wird, und die alles übersteigt, was wir bisher vom Glück kennen.
Auf die innere Einstellung kommt es an. Darin haben manche Ratgeber, die wir kaufen können, Recht. Allein: Für uns als Christinnen und Christen ist diese innere Einstellung unser Vertrauen auf Gott. Wir danken ihm für all das Glück, das er uns erleben lässt: für das Glück der Liebe, das Glück der Freundschaft, das Glück des Erfolgs – für all das Schöne, das auf uns wartet. „Du wirst mich nicht der Verwesung preisgeben, ich gehöre ja zu dir.“ Denn wir sind zum Leben bestimmt! Die Jahre, die Gott uns schenkt, führt und leitet er uns, lässt uns seine Liebe und seinen Segen spüren.
Lasst uns einmal gemeinsam diesen Psalm 16 sprechen, um diese Liebe, diesen Segen, dieses Glück mit und in Gott zu spüren.
Liebe Gemeinde: seid ihr glücklich? So unvermutet kommt die Frage jetzt nicht mehr. Vielleicht sind wir glücklicher, als wir denken. Es kommt auf den Blick an: den Blick auf unser Leben und den Blick auf Gott.
Er gebe uns, dass wir unbeschwert, dankbar und erwartungsvoll antworten können: „Ja, ich bin glücklich!“ Oder in den Worten unseres Psalms: „Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir; aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück.“
Und damit: Herzlichen Glückwunsch uns allen! Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus!
Amen!
Drag and Drop Website Builder